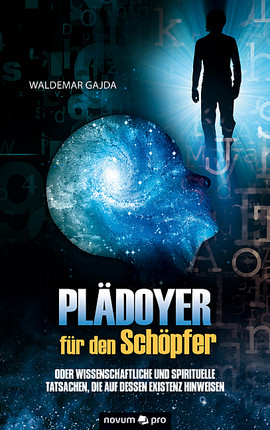Gedanken an der Grenze zwischen Naturwissenschaften und Philosophie
Hans Delfs
EUR 16,90
EUR 13,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 106
ISBN: 978-3-99146-043-5
Erscheinungsdatum: 11.05.2023
Ein leicht verständliches Buch über die Entwicklung unseres Geisteslebens aus evolutionär geformten Anlagen und den Eindrücken, die wir aus einer vollkommen determinierten, aber durch einen unüberwindlichen Graben von uns getrennten äußeren Welt erhalten..
Einführung
Die Überlegungen, die zu diesem kleinen Buch geführt haben, nahmen ihren Anfang auf regelmäßigen morgendlichen Waldspaziergängen. Irgendwann kam ich auf die Idee, das niederzuschreiben, was ich dabei über meine Existenz gedacht habe. Genau genommen aber liegt der Ursprung bereits im Jahre 1954, als der Lehrer im schulischen Philosophieunterricht die grundsätzliche Trennung zwischen den inneren Vorstellungen von der Welt und der äußeren Welt erwähnte, die durch einen unüberwindlichen Graben voneinander getrennt sind. Das schlug bei mir ein wie eine Bombe mit der Erkenntnis: „Donnerwetter, das ist ja wahr! Ich lebe wirklich nur in den Vorgängen, die sich in meinem Hirn abspielen!“ Diese Sicht stellte sich für mich unmittelbar ein, bedurfte keines Beweises und keiner Philosophie und ist bestimmend für mein ganzes Leben geworden.
Mein Physikstudium war stark von dieser fundamentalen Trennung zwischen der persönlichen geistigen Welt und dem unbekannten „Ding an sich“ bestimmt. Das brachte mich zur Ablehnung vieler philosophischer Thesen, die damit nicht kompatibel waren, und in der Folge zu einem ausgesprochenen Desinteresse an philosophischen Fragen. Erst heute, in meinem hohen Alter, hat sich das ein wenig geändert, und diese Gedanken eines Physikers haben mehr philosophischen als naturwissenschaftlichen Charakter. Allerdings sind meine philosophischen Überlegungen laienhaft. Ich muss offen zugeben, dass viel von dem, was professionelle Philosophen über manche der hier angesprochenen Themen schreiben, mir unverständlich bleibt. Das liegt unter anderem daran, dass das Interesse der meisten Philosophen komplexen Phänomenen der menschlichen Existenz gilt, die oft in wolkigen Begriffen ausgedrückt werden. In Beziehung zu den eigentlichen Vorgängen im menschlichen Geist ist dies eine Top-down-Analyse. Das Denken wird dabei ebenfalls als ein komplexer Vorgang angesehen, der die Sprache als Ausdrucksmittel zur Voraussetzung hat.
Meine Überlegungen aber gehen von den Elementarvorgängen im Geist aus, zu denen wir bereits in der Lage sind, wenn wir auf die Welt kommen. Insbesondere sehe ich im Vorgang des Denkens etwas sehr Einfaches, nämlich die Verknüpfung von Vorstellungen mit ganz elementaren Beziehungen. Dieser Vorgang allerdings wird millionenfach wiederholt, um zu den komplexen Inhalten zu gelangen, die die meisten Philosophen beschäftigen. Meine Überlegungen haben eine Bottom-up-Struktur. Die meisten Philosophen werden meine Darstellung als hoffnungslos vereinfacht ansehen, während ich umgekehrt nicht in der Lage bin, ihre hochdifferenzierten Analysen (einschließlich des dazugehörigen Vokabulars) nachzuvollziehen.
Doch auch meine naturwissenschaftlichen Überlegungen sind unvollständig, weil die Naturwissenschaften ein so großes Gebiet sind, dass kein Mensch sie übersehen kann. So bleibt das Einzige, auf dem ich hier wirklich fußen kann, der sogenannte gesunde Menschenverstand. Daher müsste das, was ich hier schreibe, im Prinzip für jeden verständlich sein, doch intensives Mitdenken bleibt dem Leser nicht erspart.
Die Tatsache, dass jedes naturwissenschaftliche Denken immer an philosophische Fragen grenzt, ergibt sich aus zwei Gründen. Einerseits ist die Maschine, mit der ich denke, mein Hirn also, ein Gegenstand der Naturwissenschaften, während die Inhalte des Denkens, Begriffe und Vorstellungen, in den Bereich der Philosophie gehören. Andererseits beruhen die gesamten Naturwissenschaften auf Beobachtungen, doch die Frage, wie eine Beobachtung zu einer Vorstellung in meinem Geist führt, hat philosophischen Charakter.
Ich denke nicht an Beweise im Sinne philosophischer Logik. Obwohl diese bei vielen Philosophen sehr geschätzt und gepflegt wird, habe ich zu ihrer Nützlichkeit meine Zweifel. Das Theoriegebäude der philosophischen Logik konnte nur entstehen, weil im Denken eine Logik angelegt ist. Ich nehme an, dass es sich dabei um einen Teil der menschlichen Grundausstattung handelt. Für meine Begriffe reicht diese Fähigkeit für das hier zu Entwickelnde völlig aus, und wo sie nicht ausreicht, helfen auch Syllogismen nicht weiter. Sogar in der Mathematik hat die philosophische Logik für meine Begriffe hauptsächlich akademischen Wert.
Ich gehe davon aus, dass alle Gedanken, die ich hier niederschreibe, bereits früher von anderen gedacht worden sind, vielleicht nicht in diesem Gesamtzusammenhang. Das, was eigenen Überlegungen entspringt, ist normal gesetzt. Doch lese ich auch Gedanken anderer, auf die ich selbst nicht gekommen bin oder auch nicht kommen konnte. Diese Dinge schiebe ich in Kursivschrift ein.
Ich bin kein Kenner der philosophischen Literatur. Das liegt daran, dass ich lange Jahre um diese Disziplin einen großen Bogen gemacht habe und meine wenigen Versuche damit enttäuscht abgebrochen habe, weil ich regelmäßig auf Systeme stieß, die ich bereits in ihren Grundlagen nicht nachvollziehen konnte und denen ich wenig Relevanz für mein persönliches Leben zu geben bereit war. So stammen heute meine Kenntnisse dazu zum größten Teil aus Sekundärliteratur.
Bei einem oberflächlichen Überblick über die Philosophiegeschichte habe ich zwei Feststellungen getroffen. Die erste ist die Tatsache, dass im Laufe von fast drei Jahrtausenden die Naturwissenschaften, die ursprünglich Teil der Philosophie waren, in ihrem beispiellosen Aufstieg große Teile der Philosophie erobert oder ihnen die Relevanz entzogen haben. Der entscheidende Schritt, der die Loslösung der Naturwissenschaften von der Philosophie und ihren Erfolg ermöglichte, war ein einziges Prinzip, nämlich die Idee, dass der Beobachtung absolute Priorität gegenüber intuitiven Erkenntnissen einzuräumen ist. Dieser Gedanke beherrscht als empirisches Prinzip alle Naturwissenschaften und liegt meinen Ausführungen zugrunde. Dieses Prinzip ist nie unumstritten gewesen. Sogar ein Geist vom Format eines Goethe, dem beobachtende und beschreibende Disziplinen viel verdanken, konnte sich nicht zu einer Anerkennung der ihm genau bekannten empirischen Nachweise einer Zerlegung des weißen Lichts in die Spektralfarben entschließen. Stattdessen hielt er seine intuitive Überzeugung von der Einheit des weißen Lichts für unwiderleglich. Aus diesem Grunde ist sein Beitrag zur Physik in der Farbenlehre, die er selbst als sein wichtigstes Lebenswerk betrachtete, naturwissenschaftlich unbedeutend geblieben.
Die zweite Feststellung ist, dass sich viel von dem, was ich gedanklich für mich entwickelt habe, bereits in ähnlicher oder gleicher Weise bei anderen findet, ohne dass es mein Denken beeinflusst hat. Bei den englischen Philosophen der Aufklärung, vor allem bei Hume, aber auch bei Kant und bei verschiedenen neueren Philosophen finde ich eine Reihe verwandter Gedanken. Doch es gibt auch bei allen bestimmte Punkte, in denen ich ganz entschieden anderer Ansicht bin. Meist liegt das an den Rollen der Religion, der Empirie oder daran, dass Erlebniswelt und äußere Welt nicht sorgfältig getrennt werden.
Meine Überlegungen waren anfangs rein introspektiv und gingen von der Frage aus, wie das meiste von dem, was in meinem Geist vorgeht, über die Sinne zustande kommt. Dieser Betrachtungsweise entspricht die Ich-Perspektive, die ich vielfach benutzen werde. Es hat sich aber dann gezeigt, dass parallel zur Introspektion einige weitere Denklinien eng damit zusammenhängen. Die erste davon ist die Betrachtung der geistigen Entwicklung von Kleinkindern, die ich mit meinen introspektiven Betrachtungen vergleichen werde. Dabei lässt sich eine weitgehende Parallelität zwischen diesen Beobachtungen und meiner Introspektion feststellen.
Eine weitere Denklinie entstammt den Naturwissenschaften, nämlich die Tatsache, dass ich nur mit den Eigenschaften und Fähigkeiten arbeiten kann, die mir die Natur bei der Geburt mitgegeben hat. Was alles zu dieser in der Evolution festgelegten Grundausstattung gehört, ist umstritten und teilweise Gegenstand der Forschung. Im Laufe der Darstellung werde ich immer wieder auf Dinge stoßen, die vermutlich zur Grundausstattung gehören und die ich in einem eigenen Abschnitt besprechen werde.
Die bisher skizzierten Inhalte werde ich im ersten Teil dieser Überlegungen behandeln. In diesem Teil wird implizit vorausgesetzt, dass ich einen freien Willen habe und mich deshalb für Handlungen, die von Willensimpulsen meines Geistes ausgehen, frei entscheiden kann. Ich werde aber feststellen, dass es eine Art übergeordnete Regel der Naturwissenschaften gibt. Das ist die Erfahrung, dass alles, was geschieht, auf eine Ursache zurückgeht und dass bei einer genau bekannten Ursache in der Regel die gleichen Folgen beobachtet werden, das Kausalgesetz. Kausalität ist bei genauer Betrachtung wie alle Naturgesetze kein wirkliches Gesetz, sondern nur eine Erfahrungstatsache, allerdings eine sehr bewährte. Sie führt jedoch zu einer durch Jahrhunderte der Philosophie umstrittenen Frage: Gibt es einen freien Willen oder ist alles determiniert, d. h. durch das Kausalgesetz bestimmt?
Hier hat die Hirnforschung der letzten 50 Jahre zu sehr revolutionären Auffassungen geführt. Ich werde auf diese Forschungen nur insofern eingehen, als sie die Existenz eines freien Willens betreffen. Diese haben allerdings zu Schlüssen geführt, welche die in Teil 1 angestellten Betrachtungen in radikaler Weise verändern, zum Teil ad absurdum führen, zum Teil aber auch ihre Berechtigung untermauern. Es ist daher angebracht, diese Überlegungen in einem zweiten Teil abzutrennen und sorgfältig zu diskutieren.
Teil 1
Introspektive Überlegungen
Sprachliche Festlegungen
Ich möchte meine sprachlichen Festlegungen vorab erläutern, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden. Weiterhin möchte ich mich, soweit es mir möglich ist, der deutschen Umgangssprache bedienen.
Geist: Den „Behälter“ sämtlicher bewusster Vorgänge, die wir biologisch in unserem Gehirn verorten, bezeichne ich als Geist. Der Geist ist demnach nichts Transzendentes. Im Sinne der Gedächtnispsychologie ist er vor allem im Arbeitsgedächtnis repräsentiert. Da ich über unbewusste Vorgänge wenig sagen kann, betrachte ich fast nur bewusste Vorgänge. Der Geist in dem hier festgelegten Sinn steht in engstem Zusammenhang mit dem Bewusstsein.
Vorstellung: Ich bezeichne das inhaltliche Material der meisten bewussten Vorgänge im Geist als Vorstellungen. Dieser Begriff ist sehr umfassend und weicht vom umgangssprachlichen Gebrauch ab. Er reicht in einer vielschichtigen Hierarchie von den primitivsten Sinneseindrücken bis hinauf zu den komplexesten abstrakten Begriffen.
Beobachtung: Den Vorgang, aus den Signalen der Sinne einfachste Vorstellungen zu bilden, bezeichne ich als Beobachtung, auch ohne nennenswert andere Bedeutung als Wahrnehmung.
Erinnerung: In meinem Geist abgespeicherte und wieder rekonstruierte Vorstellungen bezeichne ich als Erinnerungen. Ich gehe hier nicht auf die von der Gedächtnispsychologie zwar intensiv, aber immer noch bei Weitem nicht erschöpfend erforschten Mechanismen der Speicherung ein, weil sie meiner Meinung nach für das, was ich darstellen möchte, keine wesentliche Rolle spielen.
Denken: Das Verknüpfen von Vorstellungen bezeichne ich als Denken. Das ist ein Elementarvorgang. Dieses Verständnis vom Denken unterscheidet sich von dem der mir bekannten Philosophien grundlegend.
Gefühle: Es gibt Wirkungen meines Körpers auf meinen Geist, die nicht über die Sinnesorgane vermittelt werden und keine Vorstellungen bewirken, die aber vom Geist bewertet werden. Diese bezeichne ich als Gefühle. Man kann zwar von Gefühlen begriffliche Vorstellungen bilden, die aber nicht identisch mit den Gefühlen sind.
Willensbefehl: Einen in meinem Geist entstehenden Impuls, auf meinen Körper einzuwirken, bezeichne ich als Willensbefehl.
Äußere Welt: Alles, was sich außerhalb des Geistes tummelt, werde ich als die äußere Welt bezeichnen. Dem entsprechend nehme ich nicht an, dass es außer meinem Geist und der äußeren Welt noch irgendetwas gibt.
Weitere sprachliche Festlegungen: Im Laufe des Textes werden weitere sprachliche Festlegungen in fetter Kursivschrift auftauchen.
Ausgangspunkt
Meiner Spekulation nach muss alles, was sich in meinem Geist abspielt, entweder bei Geburt mitgeliefert worden sein oder auf Sinneserfahrung und anderen Einflüssen aus der äußeren Welt beruhen, wobei die Trennung zwischen der äußeren Welt und den Vorgängen in meinem Geist fundamentale Bedeutung hat. Diese Trennung mache ich zum Ausgangspunkt meiner Darstellung, und zwar sehr radikal und kompromisslos. Ich wähle diesen Ausgangspunkt nicht nur, weil er in meiner eigenen philosophischen Denkentwicklung am Anfang steht, sondern auch, weil er zu den Erfahrungen aus der kindlichen Entwicklung passt.
Ich weiß zwar, dass Kant bei Weitem nicht der Erste war, der die grundsätzliche Trennung der äußeren Welt von den Vorgängen in unserem Geist formuliert hat, auch die Bezeichnung „Ding an sich“ für Gegenstände der äußeren Welt stammt nicht ursprünglich von ihm, die Formel „an sich“ wurde von ihm aber vielfach benutzt im Text seiner Kritiken. Die Relevanz dieser Trennung ist zwar immer wieder von Philosophen bestritten worden und wird auch heute vielfach bestritten, ist aber für mich selbstevident und bedarf keines Beweises.
Ich formuliere meinen Ausgangspunkt (etwas ungenau) folgendermaßen: „Von der äußeren Welt hervorgerufene Sinneseindrücke lassen in meinem Geist Vorstellungen entstehen. Ich habe aber keine Ahnung, was in der äußeren Welt zu diesen Vorstellungen führt.“ Diese Formulierung ist aus mindestens einem Grunde ungenau: Das Wörtchen „Ich“ wird hier unberechtigt verwendet, denn es hat erst eine Berechtigung, wenn ich ihm eine Bedeutung zugewiesen habe. Und es wird sich zeigen, dass gerade das ein schwieriger Punkt ist. Ich verwende dieses Wort und das damit zusammenhängende Wort „mein“ gewissermaßen vorläufig als eine praktische umgangssprachliche Formulierung meiner Aussagen. Eine genauere Wortdefinition kann ich erst weiter unten geben. Solange diese nicht vorliegt, könnte der Ausgangssatz lauten: „Es gibt Vorstellungen.“ Ich vermute, dass diese Formulierung recht gut den Anfang geistiger Tätigkeit im Geist eines Neugeborenen beschreibt. Da besteht nämlich noch kein „Ich“ und keine „Welt“ und das Einzige, was außer einer Grundausstattung angetroffen werden kann, sind die Repräsentationen der Sinnessignale.
Erst in einem fortgeschrittenen Stand dieser Überlegungen bin ich auf eine Schrift des Physikers Ernst Mach hingewiesen worden. Man könnte denken, dass er als Physiker zu ähnlichen Gedanken gekommen wäre wie ich. Doch das ist keineswegs der Fall. Machs Ausgangspunkt ist einfach die Welt und das Ich, die er beide als „relativ beständig“ und als weitgehend deckungsgleich mit den „Empfindungen“ ansieht. Eine Trennung zwischen der Welt des Erlebens und einer äußeren Welt erkennt er nicht an. Ein von den geistigen Vorgängen völlig getrenntes „Ding an sich“ ist für ihn eine philosophische Ungeheuerlichkeit.
Die philosophische Denkrichtung des Neurealismus ist den Positionen von Mach verwandt. Zwar teile ich die Ansicht, dass wir im praktischen Leben die Dinge so nehmen können, wie sie uns erscheinen, aber nicht, weil sie wirklich so und nicht anders sind, sondern weil unser Gehirn uns keine andere Möglichkeit gibt. (siehe Teil 2).
Die äußere Welt (Ding an sich) hat für mich hypothetischen Charakter, weil ich streng genommen über die äußere Welt nichts weiß. Im Grunde ist diese Hypothese Ausdruck des weiter unten zu besprechenden Kausalgesetzes in dem Sinne: Es muss zu meinen Sinneseindrücken eine Ursache geben. Die Gesamtheit dieser Ursachen bezeichne ich als die äußere Welt.
Ich denke, gegen meine Feststellung, dass die äußere Welt hypothetischen Charakter hat, könnte der Einwand vorgebracht werden, dass wir ja die physikalischen Gesetze kennen, die für die Einwirkungen der äußeren Welt auf unsere Sinne maßgeblich sind. Zum Beispiel kennen wir die Abbildungsgesetze der Physik, die den Zusammenhang eines Bildes in der äußeren Welt mit dem Bild auf unserer Netzhaut beschreiben. Ergo können wir zurückschließen, wie das in der äußeren Welt aussieht, was einen bestimmten optischen Eindruck erzeugt hat. Das ist jedoch ein Fehlschluss, denn unsere Augen sind selbst Teile der äußeren Welt, aber unsere physikalischen Gesetze beschreiben nicht Beziehungen zwischen Gegenständen und Erscheinungen in der äußeren Welt, sondern nur zwischen Vorstellungen in unserem Geist.
Ich werde im Laufe meiner Überlegungen und in meiner Bezeichnungsweise häufig den hypothetischen Charakter der äußeren Welt vernachlässigen. Das ist die normale Umgangssprache. Der sprachliche Ausdruck wird allzu umständlich, wenn man die Tatsache, dass die äußere Welt Hypothese ist, ständig mitschleppt. Den Grundsatz aber, dass die äußere Welt nur hypothetischen Charakter hat, werde ich beibehalten und mich gelegentlich daran erinnern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich etwas ferner liegende Facetten der äußeren Welt betrachte, zum Beispiel die Beobachtungen, die der Relativitätstheorie, Elementarteilchenphysik oder Kosmologie zugrunde liegen.
Es ist nicht einmal im Gedankenexperiment einzusehen, wie ein Lebewesen konstruiert sein könnte, welches ein echtes „Wissen“ seiner Umwelt besitzt, solange es selbst Teil dieser Welt ist. Zu wirklichem Wissen gehört Vollständigkeit. Dieses gedachte Wesen, das ein echtes Wissen seiner Umwelt besitzt, enthielte demnach die gesamte Welt in Kopie, und damit auch sich selbst. Und hier zeigt sich der Widerspruch.
Bereits hier ist ein kurzer Exkurs zur Evolution angebracht: Für unsere Orientierung in der Umwelt und unser Überleben ist die Frage, ob ich irgendein wirkliches Wissen über eine tatsächliche Umwelt haben kann oder ob ich nur ein von mir selbst aufgrund der Sinnessignale konstruiertes „Bild“ der äußeren Welt kenne, vollkommen unwichtig, solange es zwischen beiden eine zuverlässige Beziehung gibt, die es mir gestattet, Gefahren und Gelegenheiten in der überwiegenden Zahl der Fälle richtig einzuschätzen. Genau das scheint unsere Ausstattung mit Sinnen und dem Nervensystem zu leisten. Mehr dazu folgt im Teil 2 dieser Überlegungen.
Die Überlegungen, die zu diesem kleinen Buch geführt haben, nahmen ihren Anfang auf regelmäßigen morgendlichen Waldspaziergängen. Irgendwann kam ich auf die Idee, das niederzuschreiben, was ich dabei über meine Existenz gedacht habe. Genau genommen aber liegt der Ursprung bereits im Jahre 1954, als der Lehrer im schulischen Philosophieunterricht die grundsätzliche Trennung zwischen den inneren Vorstellungen von der Welt und der äußeren Welt erwähnte, die durch einen unüberwindlichen Graben voneinander getrennt sind. Das schlug bei mir ein wie eine Bombe mit der Erkenntnis: „Donnerwetter, das ist ja wahr! Ich lebe wirklich nur in den Vorgängen, die sich in meinem Hirn abspielen!“ Diese Sicht stellte sich für mich unmittelbar ein, bedurfte keines Beweises und keiner Philosophie und ist bestimmend für mein ganzes Leben geworden.
Mein Physikstudium war stark von dieser fundamentalen Trennung zwischen der persönlichen geistigen Welt und dem unbekannten „Ding an sich“ bestimmt. Das brachte mich zur Ablehnung vieler philosophischer Thesen, die damit nicht kompatibel waren, und in der Folge zu einem ausgesprochenen Desinteresse an philosophischen Fragen. Erst heute, in meinem hohen Alter, hat sich das ein wenig geändert, und diese Gedanken eines Physikers haben mehr philosophischen als naturwissenschaftlichen Charakter. Allerdings sind meine philosophischen Überlegungen laienhaft. Ich muss offen zugeben, dass viel von dem, was professionelle Philosophen über manche der hier angesprochenen Themen schreiben, mir unverständlich bleibt. Das liegt unter anderem daran, dass das Interesse der meisten Philosophen komplexen Phänomenen der menschlichen Existenz gilt, die oft in wolkigen Begriffen ausgedrückt werden. In Beziehung zu den eigentlichen Vorgängen im menschlichen Geist ist dies eine Top-down-Analyse. Das Denken wird dabei ebenfalls als ein komplexer Vorgang angesehen, der die Sprache als Ausdrucksmittel zur Voraussetzung hat.
Meine Überlegungen aber gehen von den Elementarvorgängen im Geist aus, zu denen wir bereits in der Lage sind, wenn wir auf die Welt kommen. Insbesondere sehe ich im Vorgang des Denkens etwas sehr Einfaches, nämlich die Verknüpfung von Vorstellungen mit ganz elementaren Beziehungen. Dieser Vorgang allerdings wird millionenfach wiederholt, um zu den komplexen Inhalten zu gelangen, die die meisten Philosophen beschäftigen. Meine Überlegungen haben eine Bottom-up-Struktur. Die meisten Philosophen werden meine Darstellung als hoffnungslos vereinfacht ansehen, während ich umgekehrt nicht in der Lage bin, ihre hochdifferenzierten Analysen (einschließlich des dazugehörigen Vokabulars) nachzuvollziehen.
Doch auch meine naturwissenschaftlichen Überlegungen sind unvollständig, weil die Naturwissenschaften ein so großes Gebiet sind, dass kein Mensch sie übersehen kann. So bleibt das Einzige, auf dem ich hier wirklich fußen kann, der sogenannte gesunde Menschenverstand. Daher müsste das, was ich hier schreibe, im Prinzip für jeden verständlich sein, doch intensives Mitdenken bleibt dem Leser nicht erspart.
Die Tatsache, dass jedes naturwissenschaftliche Denken immer an philosophische Fragen grenzt, ergibt sich aus zwei Gründen. Einerseits ist die Maschine, mit der ich denke, mein Hirn also, ein Gegenstand der Naturwissenschaften, während die Inhalte des Denkens, Begriffe und Vorstellungen, in den Bereich der Philosophie gehören. Andererseits beruhen die gesamten Naturwissenschaften auf Beobachtungen, doch die Frage, wie eine Beobachtung zu einer Vorstellung in meinem Geist führt, hat philosophischen Charakter.
Ich denke nicht an Beweise im Sinne philosophischer Logik. Obwohl diese bei vielen Philosophen sehr geschätzt und gepflegt wird, habe ich zu ihrer Nützlichkeit meine Zweifel. Das Theoriegebäude der philosophischen Logik konnte nur entstehen, weil im Denken eine Logik angelegt ist. Ich nehme an, dass es sich dabei um einen Teil der menschlichen Grundausstattung handelt. Für meine Begriffe reicht diese Fähigkeit für das hier zu Entwickelnde völlig aus, und wo sie nicht ausreicht, helfen auch Syllogismen nicht weiter. Sogar in der Mathematik hat die philosophische Logik für meine Begriffe hauptsächlich akademischen Wert.
Ich gehe davon aus, dass alle Gedanken, die ich hier niederschreibe, bereits früher von anderen gedacht worden sind, vielleicht nicht in diesem Gesamtzusammenhang. Das, was eigenen Überlegungen entspringt, ist normal gesetzt. Doch lese ich auch Gedanken anderer, auf die ich selbst nicht gekommen bin oder auch nicht kommen konnte. Diese Dinge schiebe ich in Kursivschrift ein.
Ich bin kein Kenner der philosophischen Literatur. Das liegt daran, dass ich lange Jahre um diese Disziplin einen großen Bogen gemacht habe und meine wenigen Versuche damit enttäuscht abgebrochen habe, weil ich regelmäßig auf Systeme stieß, die ich bereits in ihren Grundlagen nicht nachvollziehen konnte und denen ich wenig Relevanz für mein persönliches Leben zu geben bereit war. So stammen heute meine Kenntnisse dazu zum größten Teil aus Sekundärliteratur.
Bei einem oberflächlichen Überblick über die Philosophiegeschichte habe ich zwei Feststellungen getroffen. Die erste ist die Tatsache, dass im Laufe von fast drei Jahrtausenden die Naturwissenschaften, die ursprünglich Teil der Philosophie waren, in ihrem beispiellosen Aufstieg große Teile der Philosophie erobert oder ihnen die Relevanz entzogen haben. Der entscheidende Schritt, der die Loslösung der Naturwissenschaften von der Philosophie und ihren Erfolg ermöglichte, war ein einziges Prinzip, nämlich die Idee, dass der Beobachtung absolute Priorität gegenüber intuitiven Erkenntnissen einzuräumen ist. Dieser Gedanke beherrscht als empirisches Prinzip alle Naturwissenschaften und liegt meinen Ausführungen zugrunde. Dieses Prinzip ist nie unumstritten gewesen. Sogar ein Geist vom Format eines Goethe, dem beobachtende und beschreibende Disziplinen viel verdanken, konnte sich nicht zu einer Anerkennung der ihm genau bekannten empirischen Nachweise einer Zerlegung des weißen Lichts in die Spektralfarben entschließen. Stattdessen hielt er seine intuitive Überzeugung von der Einheit des weißen Lichts für unwiderleglich. Aus diesem Grunde ist sein Beitrag zur Physik in der Farbenlehre, die er selbst als sein wichtigstes Lebenswerk betrachtete, naturwissenschaftlich unbedeutend geblieben.
Die zweite Feststellung ist, dass sich viel von dem, was ich gedanklich für mich entwickelt habe, bereits in ähnlicher oder gleicher Weise bei anderen findet, ohne dass es mein Denken beeinflusst hat. Bei den englischen Philosophen der Aufklärung, vor allem bei Hume, aber auch bei Kant und bei verschiedenen neueren Philosophen finde ich eine Reihe verwandter Gedanken. Doch es gibt auch bei allen bestimmte Punkte, in denen ich ganz entschieden anderer Ansicht bin. Meist liegt das an den Rollen der Religion, der Empirie oder daran, dass Erlebniswelt und äußere Welt nicht sorgfältig getrennt werden.
Meine Überlegungen waren anfangs rein introspektiv und gingen von der Frage aus, wie das meiste von dem, was in meinem Geist vorgeht, über die Sinne zustande kommt. Dieser Betrachtungsweise entspricht die Ich-Perspektive, die ich vielfach benutzen werde. Es hat sich aber dann gezeigt, dass parallel zur Introspektion einige weitere Denklinien eng damit zusammenhängen. Die erste davon ist die Betrachtung der geistigen Entwicklung von Kleinkindern, die ich mit meinen introspektiven Betrachtungen vergleichen werde. Dabei lässt sich eine weitgehende Parallelität zwischen diesen Beobachtungen und meiner Introspektion feststellen.
Eine weitere Denklinie entstammt den Naturwissenschaften, nämlich die Tatsache, dass ich nur mit den Eigenschaften und Fähigkeiten arbeiten kann, die mir die Natur bei der Geburt mitgegeben hat. Was alles zu dieser in der Evolution festgelegten Grundausstattung gehört, ist umstritten und teilweise Gegenstand der Forschung. Im Laufe der Darstellung werde ich immer wieder auf Dinge stoßen, die vermutlich zur Grundausstattung gehören und die ich in einem eigenen Abschnitt besprechen werde.
Die bisher skizzierten Inhalte werde ich im ersten Teil dieser Überlegungen behandeln. In diesem Teil wird implizit vorausgesetzt, dass ich einen freien Willen habe und mich deshalb für Handlungen, die von Willensimpulsen meines Geistes ausgehen, frei entscheiden kann. Ich werde aber feststellen, dass es eine Art übergeordnete Regel der Naturwissenschaften gibt. Das ist die Erfahrung, dass alles, was geschieht, auf eine Ursache zurückgeht und dass bei einer genau bekannten Ursache in der Regel die gleichen Folgen beobachtet werden, das Kausalgesetz. Kausalität ist bei genauer Betrachtung wie alle Naturgesetze kein wirkliches Gesetz, sondern nur eine Erfahrungstatsache, allerdings eine sehr bewährte. Sie führt jedoch zu einer durch Jahrhunderte der Philosophie umstrittenen Frage: Gibt es einen freien Willen oder ist alles determiniert, d. h. durch das Kausalgesetz bestimmt?
Hier hat die Hirnforschung der letzten 50 Jahre zu sehr revolutionären Auffassungen geführt. Ich werde auf diese Forschungen nur insofern eingehen, als sie die Existenz eines freien Willens betreffen. Diese haben allerdings zu Schlüssen geführt, welche die in Teil 1 angestellten Betrachtungen in radikaler Weise verändern, zum Teil ad absurdum führen, zum Teil aber auch ihre Berechtigung untermauern. Es ist daher angebracht, diese Überlegungen in einem zweiten Teil abzutrennen und sorgfältig zu diskutieren.
Teil 1
Introspektive Überlegungen
Sprachliche Festlegungen
Ich möchte meine sprachlichen Festlegungen vorab erläutern, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden. Weiterhin möchte ich mich, soweit es mir möglich ist, der deutschen Umgangssprache bedienen.
Geist: Den „Behälter“ sämtlicher bewusster Vorgänge, die wir biologisch in unserem Gehirn verorten, bezeichne ich als Geist. Der Geist ist demnach nichts Transzendentes. Im Sinne der Gedächtnispsychologie ist er vor allem im Arbeitsgedächtnis repräsentiert. Da ich über unbewusste Vorgänge wenig sagen kann, betrachte ich fast nur bewusste Vorgänge. Der Geist in dem hier festgelegten Sinn steht in engstem Zusammenhang mit dem Bewusstsein.
Vorstellung: Ich bezeichne das inhaltliche Material der meisten bewussten Vorgänge im Geist als Vorstellungen. Dieser Begriff ist sehr umfassend und weicht vom umgangssprachlichen Gebrauch ab. Er reicht in einer vielschichtigen Hierarchie von den primitivsten Sinneseindrücken bis hinauf zu den komplexesten abstrakten Begriffen.
Beobachtung: Den Vorgang, aus den Signalen der Sinne einfachste Vorstellungen zu bilden, bezeichne ich als Beobachtung, auch ohne nennenswert andere Bedeutung als Wahrnehmung.
Erinnerung: In meinem Geist abgespeicherte und wieder rekonstruierte Vorstellungen bezeichne ich als Erinnerungen. Ich gehe hier nicht auf die von der Gedächtnispsychologie zwar intensiv, aber immer noch bei Weitem nicht erschöpfend erforschten Mechanismen der Speicherung ein, weil sie meiner Meinung nach für das, was ich darstellen möchte, keine wesentliche Rolle spielen.
Denken: Das Verknüpfen von Vorstellungen bezeichne ich als Denken. Das ist ein Elementarvorgang. Dieses Verständnis vom Denken unterscheidet sich von dem der mir bekannten Philosophien grundlegend.
Gefühle: Es gibt Wirkungen meines Körpers auf meinen Geist, die nicht über die Sinnesorgane vermittelt werden und keine Vorstellungen bewirken, die aber vom Geist bewertet werden. Diese bezeichne ich als Gefühle. Man kann zwar von Gefühlen begriffliche Vorstellungen bilden, die aber nicht identisch mit den Gefühlen sind.
Willensbefehl: Einen in meinem Geist entstehenden Impuls, auf meinen Körper einzuwirken, bezeichne ich als Willensbefehl.
Äußere Welt: Alles, was sich außerhalb des Geistes tummelt, werde ich als die äußere Welt bezeichnen. Dem entsprechend nehme ich nicht an, dass es außer meinem Geist und der äußeren Welt noch irgendetwas gibt.
Weitere sprachliche Festlegungen: Im Laufe des Textes werden weitere sprachliche Festlegungen in fetter Kursivschrift auftauchen.
Ausgangspunkt
Meiner Spekulation nach muss alles, was sich in meinem Geist abspielt, entweder bei Geburt mitgeliefert worden sein oder auf Sinneserfahrung und anderen Einflüssen aus der äußeren Welt beruhen, wobei die Trennung zwischen der äußeren Welt und den Vorgängen in meinem Geist fundamentale Bedeutung hat. Diese Trennung mache ich zum Ausgangspunkt meiner Darstellung, und zwar sehr radikal und kompromisslos. Ich wähle diesen Ausgangspunkt nicht nur, weil er in meiner eigenen philosophischen Denkentwicklung am Anfang steht, sondern auch, weil er zu den Erfahrungen aus der kindlichen Entwicklung passt.
Ich weiß zwar, dass Kant bei Weitem nicht der Erste war, der die grundsätzliche Trennung der äußeren Welt von den Vorgängen in unserem Geist formuliert hat, auch die Bezeichnung „Ding an sich“ für Gegenstände der äußeren Welt stammt nicht ursprünglich von ihm, die Formel „an sich“ wurde von ihm aber vielfach benutzt im Text seiner Kritiken. Die Relevanz dieser Trennung ist zwar immer wieder von Philosophen bestritten worden und wird auch heute vielfach bestritten, ist aber für mich selbstevident und bedarf keines Beweises.
Ich formuliere meinen Ausgangspunkt (etwas ungenau) folgendermaßen: „Von der äußeren Welt hervorgerufene Sinneseindrücke lassen in meinem Geist Vorstellungen entstehen. Ich habe aber keine Ahnung, was in der äußeren Welt zu diesen Vorstellungen führt.“ Diese Formulierung ist aus mindestens einem Grunde ungenau: Das Wörtchen „Ich“ wird hier unberechtigt verwendet, denn es hat erst eine Berechtigung, wenn ich ihm eine Bedeutung zugewiesen habe. Und es wird sich zeigen, dass gerade das ein schwieriger Punkt ist. Ich verwende dieses Wort und das damit zusammenhängende Wort „mein“ gewissermaßen vorläufig als eine praktische umgangssprachliche Formulierung meiner Aussagen. Eine genauere Wortdefinition kann ich erst weiter unten geben. Solange diese nicht vorliegt, könnte der Ausgangssatz lauten: „Es gibt Vorstellungen.“ Ich vermute, dass diese Formulierung recht gut den Anfang geistiger Tätigkeit im Geist eines Neugeborenen beschreibt. Da besteht nämlich noch kein „Ich“ und keine „Welt“ und das Einzige, was außer einer Grundausstattung angetroffen werden kann, sind die Repräsentationen der Sinnessignale.
Erst in einem fortgeschrittenen Stand dieser Überlegungen bin ich auf eine Schrift des Physikers Ernst Mach hingewiesen worden. Man könnte denken, dass er als Physiker zu ähnlichen Gedanken gekommen wäre wie ich. Doch das ist keineswegs der Fall. Machs Ausgangspunkt ist einfach die Welt und das Ich, die er beide als „relativ beständig“ und als weitgehend deckungsgleich mit den „Empfindungen“ ansieht. Eine Trennung zwischen der Welt des Erlebens und einer äußeren Welt erkennt er nicht an. Ein von den geistigen Vorgängen völlig getrenntes „Ding an sich“ ist für ihn eine philosophische Ungeheuerlichkeit.
Die philosophische Denkrichtung des Neurealismus ist den Positionen von Mach verwandt. Zwar teile ich die Ansicht, dass wir im praktischen Leben die Dinge so nehmen können, wie sie uns erscheinen, aber nicht, weil sie wirklich so und nicht anders sind, sondern weil unser Gehirn uns keine andere Möglichkeit gibt. (siehe Teil 2).
Die äußere Welt (Ding an sich) hat für mich hypothetischen Charakter, weil ich streng genommen über die äußere Welt nichts weiß. Im Grunde ist diese Hypothese Ausdruck des weiter unten zu besprechenden Kausalgesetzes in dem Sinne: Es muss zu meinen Sinneseindrücken eine Ursache geben. Die Gesamtheit dieser Ursachen bezeichne ich als die äußere Welt.
Ich denke, gegen meine Feststellung, dass die äußere Welt hypothetischen Charakter hat, könnte der Einwand vorgebracht werden, dass wir ja die physikalischen Gesetze kennen, die für die Einwirkungen der äußeren Welt auf unsere Sinne maßgeblich sind. Zum Beispiel kennen wir die Abbildungsgesetze der Physik, die den Zusammenhang eines Bildes in der äußeren Welt mit dem Bild auf unserer Netzhaut beschreiben. Ergo können wir zurückschließen, wie das in der äußeren Welt aussieht, was einen bestimmten optischen Eindruck erzeugt hat. Das ist jedoch ein Fehlschluss, denn unsere Augen sind selbst Teile der äußeren Welt, aber unsere physikalischen Gesetze beschreiben nicht Beziehungen zwischen Gegenständen und Erscheinungen in der äußeren Welt, sondern nur zwischen Vorstellungen in unserem Geist.
Ich werde im Laufe meiner Überlegungen und in meiner Bezeichnungsweise häufig den hypothetischen Charakter der äußeren Welt vernachlässigen. Das ist die normale Umgangssprache. Der sprachliche Ausdruck wird allzu umständlich, wenn man die Tatsache, dass die äußere Welt Hypothese ist, ständig mitschleppt. Den Grundsatz aber, dass die äußere Welt nur hypothetischen Charakter hat, werde ich beibehalten und mich gelegentlich daran erinnern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich etwas ferner liegende Facetten der äußeren Welt betrachte, zum Beispiel die Beobachtungen, die der Relativitätstheorie, Elementarteilchenphysik oder Kosmologie zugrunde liegen.
Es ist nicht einmal im Gedankenexperiment einzusehen, wie ein Lebewesen konstruiert sein könnte, welches ein echtes „Wissen“ seiner Umwelt besitzt, solange es selbst Teil dieser Welt ist. Zu wirklichem Wissen gehört Vollständigkeit. Dieses gedachte Wesen, das ein echtes Wissen seiner Umwelt besitzt, enthielte demnach die gesamte Welt in Kopie, und damit auch sich selbst. Und hier zeigt sich der Widerspruch.
Bereits hier ist ein kurzer Exkurs zur Evolution angebracht: Für unsere Orientierung in der Umwelt und unser Überleben ist die Frage, ob ich irgendein wirkliches Wissen über eine tatsächliche Umwelt haben kann oder ob ich nur ein von mir selbst aufgrund der Sinnessignale konstruiertes „Bild“ der äußeren Welt kenne, vollkommen unwichtig, solange es zwischen beiden eine zuverlässige Beziehung gibt, die es mir gestattet, Gefahren und Gelegenheiten in der überwiegenden Zahl der Fälle richtig einzuschätzen. Genau das scheint unsere Ausstattung mit Sinnen und dem Nervensystem zu leisten. Mehr dazu folgt im Teil 2 dieser Überlegungen.