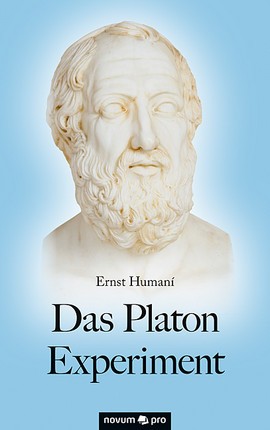Zwischen Hölle und Himmel
Mein Leben als Manisch-Depressiver
Kevin Hauser
EUR 13,90
EUR 8,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 88
ISBN: 978-3-99048-022-9
Erscheinungsdatum: 22.04.2015
Außerordentlicher Bericht eines Manisch-Depressiven. Bis zu seinem 8. Lebensjahr wächst Kevin in einer normalen Familie auf. Dann wird sein Vater krank und Kevins Leidensweg beginnt. Er wird manisch-depressiv und pendelt zwischen Faszination und Hölle. Durch ein tiefgreifendes Erlebnis entdeckt Kevin ungeahnte Kräfte und findet seinen Weg.
8. Kapitel
Inzwischen hatte ich begonnen, Gitarre zu spielen. Musik hat mir immer gefallen. Ebenso trainierte ich weiterhin Karate, so intensiv, als ginge es ums Überleben. Daneben malte ich Bild um Bild. Woher kam nur diese Energie?
Das Glück war weiterhin auf meiner Seite. Als einmal sehr viel Geld im Jackpot lag, habe ich Lotto gespielt. Und fünf Richtige angekreuzt. Ich konnte es kaum fassen. Es hätte noch viel besser kommen können. Meine sechste angekreuzte Zahl war eine vierzehn. Zusatzzahl war sechzehn und die Zahl für den Sechser eine fünfzehn. Ich freute mich trotzdem riesig und kaufte mir eine gute Stereoanlage.
Zu der Zeit unternahm ich viel mit Adrian. Mit ihm hatte ich schon die Sekundarschule und später die BMS besucht. Wir verstanden uns blendend. Wir „trampten“ an viele Open Airs oder verbrachten den Abend nach der Arbeit miteinander. Doch plötzlich sagte er zu mir, ich fände immer alles gut, sei von allem begeistert und sei ständig mit Energie geladen. Ich hörte wohl, was er sagte, doch ich konnte nichts damit anfangen. Ich fühlte mich ausgezeichnet und tat seine Worte, die als Kritik gemeint waren, als nichtssagend ab.
Seit einiger Zeit besuchte ich einen Arzt für Therapiezwecke. Sein Name war Dr. Angehrn. Bei ihm war ich vorerst nur einmal im Monat. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Bemerkung gemacht, also musste alles in Ordnung sein.
Einmal ging ich in die Disco, weil mir nach tanzen war. Immer noch war ich getrieben von einer unbändigen Kraft, was sich an meinem Tanzstil ablesen ließ. Ich wütete unermüdlich auf der Tanzfläche, ja ich baute sogar Karate-Elemente ein. Die Umgebung nahm ich nicht mehr wahr, und das stundenlang. Mein Selbstvertrauen war riesig und ich fühlte mich unglaublich gut. Als ich schließlich am Ende der Bar eine Pause machte, stellte sich ein Mann als Besitzer der Diskothek vor. Er sagte, ich falle auf und er wünsche, dass ich sein Etablissement verlasse. Ohne Diskussion ging ich nach draußen. Ich war verletzt und machte mir Gedanken. Schon Adrian hatte mich auf meine Energie angesprochen. Doch ich war nicht in der Lage, etwas zu ändern.
Später saß ich in einer Runde mit vier Männern. Ich fühlte mich kräftig, voller Energie und hellwach. Wir diskutierten miteinander über dies und das. Ich spürte, dass ich mich in jeden Einzelnen einklinken und ihre Sätze beenden konnte. Zudem war ich omnipräsent und wusste schon im Voraus, in welcher Stimmung meine Mitredner waren. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich wies jeden darauf hin, nicht zu sagen, was er gerade sagen wollte. Ich zog alle Fäden und verblüffte, indem ich alle dort abholte, wo sie gerade waren. Im Raum war ein Knistern und die Spannung war spürbar. Der eine Kollege wurde unruhig und ich dachte, dass genau er mir feindselig gesinnt war. Doch er verharrte in der Runde. Mir machten diese Stunden etwas Angst, kam es mir doch so vor, als hätte ich einen direkten Zugang zu den Gefühlen der anderen. Wieder war ich aufgefallen. Bald mal müsste ich Pascal aufsuchen und mit ihm darüber reden.
So vergingen noch ein paar Wochen, als ich eines Abends am See spazieren ging. Plötzlich hatte ich Lust, an holzigen Jalousien meine Schlagkraft zu testen. Wie ich es im Karate gelernt hatte, schlug ich mit meiner Faust und mit aller Kraft den Laden kaputt. Gleichzeitig spürte ich einen leichten Schmerz im kleinen Finger der rechten Hand. Innerhalb der nächsten Stunde schwoll dieser stark an, worauf ich ihn mit Eis kühlte. Weil nichts nützte, suchte ich am anderen Tag einen Arzt auf. Dieser eröffnete mir, der Finger sei dreifach gebrochen und er würde ihn sogleich gipsen. Ich tänzelte in der Praxis umher und erzählte ihm Witze. Meine Energie befand sich auf dem Höhepunkt. Er verpasste mir einen Gips vom Finger bis zum Ellbogen. Dann sagte ich zum Arzt: „Sehen Sie, ich habe überhaupt keine Schmerzen“, und schlug die rechte Hand mit aller Gewalt an die Wand. Der Gips zerfiel, worauf der Arzt ein kurzes Telefongespräch führte. Wenig später erschienen zwei Polizisten in der Praxis. Ich konnte es nicht fassen, dass sie meinetwegen gekommen waren, um mich zum Bezirksarzt zu begleiten. Dort fiel mir als Erstes die Arztgehilfin auf, mit der ich ein wenig flirtete. Auch sie war freundlich mit mir.
Der Doktor saß hinter seinem breiten Schreibtisch. Die Polizisten standen hinter mir. „Herr Hauser, Ihnen geht es nicht gut, wir müssen sie in die ‚Burg‘ einweisen.“ Ich war schockiert und aggressiv. „Nicht in die ‚Burg‘!“ Ich wusste ja vom ersten Mal, wie schmerzvoll ein Aufenthalt dort war. „Lass mich los, du Schwuler“, beschimpfte ich den Arzt. Dann wehrte ich mich gegen die Polizisten, bis sie mir die Handschellen anlegten.
9. Kapitel
Auf der Fahrt zur „Burg“ sagte ich kein Wort. Was würden wohl meine Mutter und meine Schwestern sagen? In der Zentrale der Klinik, als sie mich von den Handschellen befreiten, wehrte ich mich. Ich wollte nicht hier sein und so kämpfte ich mit den Polizisten, entriss dem einen das Funkgerät und trampelte auf ihm herum. Dem anderen riss ich die Brille vom Kopf und zerstörte sie. Nach einer Viertelstunde hatten sie mich überwältigt und würgten mich so lange, bis ich ohnmächtig wurde.
Aufgewacht bin ich dann schließlich in der geschlossenen Abteilung A2-A. Wo war ich nur hingeraten? Abgeschlossene Türen, wie damals bei Vater. Dabei war es mir doch so gut gegangen. Ich war optimistisch, energiegeladen und immer gut gelaunt. Ich konnte mich nicht erinnern, dass es mir schon mal so gut gegangen wäre. Nein, ich konnte nicht akzeptieren, hier zu sein! Noch befand ich mich auf einer Sitzgruppe im Eingangsbereich. Ich erschrak ob meinen Aggressionen und sah nur noch die Telefonkabine.
Ich wollte hier raus. Und sah nicht ein, warum ich festgehalten wurde. Schließlich fühlte ich mich gut, ich war kräftig und verstand nicht, warum ich in einer geschlossenen Abteilung sein musste. Mir kam mein Vater in den Sinn, und der war schon zehn Jahre eingesperrt. Musste ich dasselbe Schicksal erleiden?
Plötzlich ergriff ich die Tür der Telefonkabine und riss sie heraus. Ich verspürte unmenschliche Kräfte und begann die Seitenwände herauszureißen und in den Wohnraum zu schmettern. Nebenbei nahm ich wahr, dass alle Patienten von der Sitzgruppe flüchteten. Sogleich erfasste ich den Pingpong-Tisch und schleuderte ihn in die Ecke. Ich wollte nicht eingesperrt sein und war total aufgeregt und stark wie ein Stier. Ob des ganzen Kraftaktes war mir entgangen, dass ich von zwölf Pflegern umzingelt wurde. Alles nur Männer. Einer hatte eine Spritze in der Hand und versuchte, mich zu beruhigen. Doch ich war nicht fähig, ihm zuzuhören. Die Spritze machte mir Angst. Der Kreis begann sich zu schließen. Ich konzentrierte mich auf den Mann mit der Spritze. Mit ein paar Fußtritten hielt ich die Meute von mir fern. Aber die Übermacht war erdrückend und sie bekamen mich zu fassen. Viele Hände drückten mich zu Boden. In diesem Moment spürte ich einen brennenden Stich in meinem rechten Bein. Sofort trugen sie mich in ein Zimmer, das nur ein Bett aus Kunststoff enthielt und nichts anderes. In der Ecke stand eine Toilette. Abgeschlossen war der Raum mit einer zehn Zentimeter dicken Eichentüre. Später sagte man mir, das sei ein Isolierzimmer.
Sofort schlief ich ein. Als ich wieder aufwachte, brannte mein rechtes Bein, ich konnte es kaum bewegen. Noch nach drei Tagen spürte ich die Nachwirkungen der Spritze. Festgehalten zu werden und mit aller Gewalt eine Spritze verpasst zu bekommen, empfand ich als psychische Vergewaltigung. Wahrscheinlich hatte ich ihnen keine andere Wahl gelassen.
Eine Woche verbrachte ich in der sogenannten Loge. Wenn das Essen hereingeschoben wurde, musste ich auf dem Bett sitzen. Langsam wurde ich ruhiger und ich wusste, um hier herauszukommen, musste ich mich benehmen. Ich fühlte mich sehr einsam und war mir nicht bewusst, was mit mir nicht stimmte. Am achten Tag öffnete eine Pflegerin die Tür und sagte, ich könne herauskommen. Ich wollte brav sein und die Regeln befolgen. Die Einzelhaft hatte bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Sie zeigte mir ein normales Zweierzimmer. Alles war besser als die „Loge“. Es hatte Kästen und am Rand stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Am Fenster hingen Vorhänge. Wie war ich froh, der Isolation entkommen zu sein.
Meine Aggressionen waren kaum mehr spürbar. Sehr erleichtert begab ich mich zur Sitzgruppe, wo ein junger Mann mit einer schwarzen Lederjacke saß. Er hatte kurzes Haar und war von sehr kräftiger Statur. Er erzählte mir, er sei achtzehn Jahre alt und vor zwei Jahren in die „Burg“ gekommen. Ich dachte mir, dass dies doch kein Ort sei für Teenager. Wir unterhielten uns noch ein Weilchen. Sein Name sei Klaus, verriet er mir. In den nächsten Tagen freundeten wir uns an. Überhaupt kam man sich hier schneller näher, möglicherweise, weil niemand etwas zu verlieren hatte.
Als ich nochmals in die „Loge“ musste, durfte ich Farben mitnehmen. So fing ich an zu malen, viele Tage hintereinander und mit voller Hingabe. Meine Leinwand waren die vier Wände. Auf einer thronte ein riesiges Kreuz im Sonnenuntergang, auf einer zweiten eine Blumenwiese. Kein Fleck war unbemalt. Als die Tür wieder geöffnet wurde, wollten alle mein Gemälde sehen. Eine Völkerwanderung hatte eingesetzt. Die Pfleger sagten, dass die Wände erst weiß überstrichen würden, wenn ich die Isolierzelle nicht mehr brauche. Ich verspürte unglaubliche Kräfte, physisch und psychisch. Auf der Abteilung war ich der unumstrittene Chef. So einflussreich war ich bisher noch nie gewesen. Klaus saß ständig bei mir. Ich hatte großen Einfluss auf ihn. Obwohl er sich von niemandem etwas sagen ließ und genau wusste, was er wollte, spürte ich den großen Respekt, den er mir entgegenbrachte. Tagsüber arbeitete er auf einem Bauernhof, von wo er immer wieder Bratwürste, Eier oder Käse mitbrachte. Er bekam die Lebensmittel geschenkt und verkaufte sie auf der Abteilung. Er war ein guter Geschäftsmann und schlug aus allem Profit. Schon bald beherrschten wir zwei die Szene. Während ich alle Fäden zog, hielt Klaus mir den Rücken frei. Langweilig wurde mir nie. Ich hoffte, diese Kraft und diesen Optimismus nach draußen retten zu können.
Anderntags hatte ich einen Termin beim Arzt. Nach einem kurzen Gespräch eröffnete er mir schonungslos, dass ich an einer manisch-depressiven Erkrankung leide. Sollte meine gefühlte Stärke in der Tat nur eine Krankheit sein? Oder war das alles ein Betrug? Natürlich wusste ich selber, dass meine Verfassung nicht normal war, musste ich doch stets starke Medikamente schlucken. Manchmal schienen sich meine Kräfte durch diese Mittel noch zu verstärken. Ich wurde nachdenklich. Meine Krankheit hatte also einen Namen, aber ich wusste überhaupt nicht, was sie bedeutete und was ich gegen sie unternehmen konnte.
Auf der Abteilung stand ein Pingpong-Tisch, an dem hauptsächlich das Pflegepersonal – unglaublich gekonnt und profimäßig – spielte. Nicht weiter erstaunlich, angesichts der vielen Stunden Übung, die sie hatten. Auch ich liebte dieses Spiel und verbrachte viel Zeit damit.
Ab und zu durften wir einen Spaziergang machen. Wenn einer fluchtgefährdet war, musste er alleine mit dem Pfleger gehen. Die anderen in Gruppen. Die Umgebung war traumhaft. Das Essen wurde auf der Abteilung serviert. Ich empfand die Essenspause immer als eine Etappe des Tages. Manchmal konnte ich nicht gut schlafen. Dann begab ich mich in das Wohnzimmer. Meistens war noch jemand anders da. Die besten Gespräche fanden in diesem Rahmen statt. Ich empfand die Bekanntschaften als sehr ehrlich und voll von Vertrauen. Im Gegensatz zu „draußen“ schien man hier nicht so schnell eine Mauer aufzubauen.
Eines Tages eröffnete mir Klaus, er wisse, wo die Kasse der Ergotherapie aufbewahrt werde. Sie sei im Wohnraum in einem Kasten mit der Nummer zwölf untergebracht. Die Schrankwand bestand aus zwanzig kleinen Schränkchen. Nummer zwölf befand sich einen Meter zwanzig über dem Boden. Klaus flehte mich an, er brauche Geld. So startete ich einen gekonnten Fußtritt und das Türchen brach auseinander. Klaus ergriff die Kasse und rannte davon. Natürlich wurden wir erwischt. Der Arzt attestierte mir immer noch Aggressionen.
Einmal wurde eine junge Frau eingewiesen. Sie war extrem unruhig, sehr laut und aggressiv. Sie lief im Korridor umher und schrie unaufhörlich. Pascal war gerade bei mir auf Besuch. Als dann plötzlich fremde Pfleger zur Tür hereinplatzten und ich im Hintergrund einen Pfleger mit einer Spritze in der Hand sah, handelte ich schnell. Ich wollte der Frau unbedingt das traumatische Erlebnis der Zwangsspritzerei ersparen. So warf ich mich an die Frau heran, stieß einige Pfleger weg und schrie mit aller Kraft: „Sie kommt freiwillig in die Isolation!“ Dann führte ich sie noch nach hinten, wo sie auch blieb.
Die Pfleger zogen mitsamt der Spritze wieder ab. Pascal, der alles beobachtet hatte, fand das eine große Show. Ich glaube, er hatte auch ein wenig Angst.
Generell war ich zufrieden mit dem Pflegepersonal. Alle boten einem das Du an. Auch mit den Ärzten hatte ich keine Probleme. Langsam realisierte ich, dass mir hier geholfen wurde.
An einem regnerischen Mittag wurden wir alle ins Wohnzimmer gebeten. Der Oberarzt setzte mit ernster Stimme zu einer Bekanntmachung an; er habe uns eine traurige Mitteilung zu machen. Benjamin, ein Mitpatient von uns, sei heute Morgen unter den Zug gegangen. Sie boten uns ihre Hilfe an, für den Fall, dass wir reden wollten. Ich konnte die folgende Nacht nicht schlafen, hatten Benjamin und ich uns doch zwei Monate gekannt.
Eine Patientin war magersüchtig. Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen. Gehen konnte sie nicht mehr, sie kroch die Wände entlang. Ihre Augen quollen riesengroß aus den Augenhöhlen, was im Vergleich zum totenkopfähnlichen Gesicht surreal aussah. Im vollen Ernst behauptete sie immer, zu dick zu sein. Eines Tages holte sie ein Krankenwagen ab ins Spital, wo sie – so hörte ich – später starb.
Ich fühlte mich immer besser, die übermäßige Energie und die Aggressionen verschwanden. Mein Austritt stand kurz bevor. Langsam wurde ich nervös. Würden meine Mitarbeiter mich noch ernst nehmen? Oder meine Freunde und meine Familie? Und würde ich in der Arbeit bestehen? An einem sonnigen Freitag konnte ich austreten. Den Wohnort hatten wir ja inzwischen gewechselt, ich wohnte anfangs mit Mutter und Karin.
10. Kapitel
So fing ich wieder an zu arbeiten. Mein Chef eröffnete mir, dass er mir Stundenlohn bezahlen werde. Ich war gar nicht erfreut. Ich hatte doch schon genug gelitten, jetzt wurde ich noch bei der Entlohnung bestraft. Dazu kam, dass ich zwei Monate lang nur stundenweise arbeiten durfte. Der manische Schub hatte mich doch sehr geschwächt. Trotzdem war ich guter Dinge, ich hatte einen unglaublichen Trip erlebt, unbändige Energie gehabt und einen grenzenlosen Optimismus verspürt. Es sollte doch möglich sein, diesen Zustand in einer gesunden Phase zu erlangen.
In dieser Zeit traf ich in einem Restaurant auf die Arztgehilfin des Bezirksarztes, der mich eingewiesen hatte. Wir kamen ins Gespräch, sie verriet mir, dass sie Claudia heiße. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Wir verabredeten uns wieder und verliebten uns ineinander. Schon bald wohnte sie teilweise bei mir. Meine Mutter lebte wieder bei Gianni und Karin suchte sich etwas Eigenes. Man könnte sagen, dass es mir zeitweise recht gut ging. Trotzdem quälten mich manchmal Depressionen oder ich war sehr melancholisch. Auf diese Weise verhielt es sich etwa ein Jahr lang. Dann wurde ich plötzlich unruhig. Ich war so umtriebig und rastlos. Claudia machte sich Sorgen und tauschte sich mit Mutter aus. Mein Arzt verordnete mir mehr Medikamente und bestellte mich in kürzeren Intervallen zu sich.
Sollte nun alles wieder von vorne beginnen?
Als mein Arzt meinte, er müsse mich einweisen, bin ich abgehauen und habe mich im Wald versteckt. Ich wurde ausgeschrieben und von der Polizei gesucht. Erstmals fühlte ich mich verfolgt und ich wusste nicht mehr, was Realität und was Einbildung war. Später überfiel mich die Polizei zu Hause und führte mich in Handschellen ab. Was war nur mit mir los? Würde ich die Kraft haben, all das noch einmal durchzustehen?
So landete ich wieder in der „Burg“. Wieder wehrte ich mich, als ginge es ums Überleben, doch die Zwangsspritze blieb mir nicht erspart. Als ich in der Isolierzelle erwachte, fühlte ich mich unverwundbar. Nichts konnte mich aufhalten. Ich wollte hier raus, die Wände erdrückten mich. Je mehr Medikamente ich bekam, umso stärkere Kräfte spürte ich in mir. Dann habe ich ein paar Stunden meditiert und mich auf die dicke Holztüre konzentriert, welche, auf die ganze Höhe verteilt, mit drei Schlössern versehen war. Es folgten Dutzende von Fußtritten, mit aller Gewalt und gezielt auf das mittlere Schloss, so lange, bis die Türe aus der Verankerung sprang. Sie hing schräg und sofort kamen Pfleger angerannt. Ein Schreiner musste mit der Bohrmaschine die Türe bearbeiten und ich bekam eine neue. Ich fühlte mich unbesiegbar, war ich doch der Erste, der je aus der „Loge“ ausgebrochen war.
Auf der Abteilung befand sich noch ein anderer Maniker. Man kann sich nicht vorstellen, welche Unruhe herrscht, wenn zwei wie ich aufeinandertreffen. Einer musste ständig weggesperrt werden. Um uns herum war die Luft elektrisiert, Energie füllte den Raum.
Ich bekam sehr viele Medikamente. Während der Körper sich müde, ja fast wie gelähmt anfühlte, war der Geist hellwach und glasklar. Es kam mir vor, als hätte sich eine körpereigene Droge aktiviert. Dann lernte ich den knapp zwanzig Jahre älteren Bernhard kennen, der sehr gerne für seine Mitpatienten kochte, aber ein Alkoholproblem hatte. Er war mir sehr sympathisch. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Wenn ich Schmerzen hatte wegen der vielen Medikamente, spielte er mir auf dem Klavier vor. Auch Tina hing mit uns rum. Sie hatte die gleichen Probleme wie Bernhard.
Inzwischen hatte ich begonnen, Gitarre zu spielen. Musik hat mir immer gefallen. Ebenso trainierte ich weiterhin Karate, so intensiv, als ginge es ums Überleben. Daneben malte ich Bild um Bild. Woher kam nur diese Energie?
Das Glück war weiterhin auf meiner Seite. Als einmal sehr viel Geld im Jackpot lag, habe ich Lotto gespielt. Und fünf Richtige angekreuzt. Ich konnte es kaum fassen. Es hätte noch viel besser kommen können. Meine sechste angekreuzte Zahl war eine vierzehn. Zusatzzahl war sechzehn und die Zahl für den Sechser eine fünfzehn. Ich freute mich trotzdem riesig und kaufte mir eine gute Stereoanlage.
Zu der Zeit unternahm ich viel mit Adrian. Mit ihm hatte ich schon die Sekundarschule und später die BMS besucht. Wir verstanden uns blendend. Wir „trampten“ an viele Open Airs oder verbrachten den Abend nach der Arbeit miteinander. Doch plötzlich sagte er zu mir, ich fände immer alles gut, sei von allem begeistert und sei ständig mit Energie geladen. Ich hörte wohl, was er sagte, doch ich konnte nichts damit anfangen. Ich fühlte mich ausgezeichnet und tat seine Worte, die als Kritik gemeint waren, als nichtssagend ab.
Seit einiger Zeit besuchte ich einen Arzt für Therapiezwecke. Sein Name war Dr. Angehrn. Bei ihm war ich vorerst nur einmal im Monat. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Bemerkung gemacht, also musste alles in Ordnung sein.
Einmal ging ich in die Disco, weil mir nach tanzen war. Immer noch war ich getrieben von einer unbändigen Kraft, was sich an meinem Tanzstil ablesen ließ. Ich wütete unermüdlich auf der Tanzfläche, ja ich baute sogar Karate-Elemente ein. Die Umgebung nahm ich nicht mehr wahr, und das stundenlang. Mein Selbstvertrauen war riesig und ich fühlte mich unglaublich gut. Als ich schließlich am Ende der Bar eine Pause machte, stellte sich ein Mann als Besitzer der Diskothek vor. Er sagte, ich falle auf und er wünsche, dass ich sein Etablissement verlasse. Ohne Diskussion ging ich nach draußen. Ich war verletzt und machte mir Gedanken. Schon Adrian hatte mich auf meine Energie angesprochen. Doch ich war nicht in der Lage, etwas zu ändern.
Später saß ich in einer Runde mit vier Männern. Ich fühlte mich kräftig, voller Energie und hellwach. Wir diskutierten miteinander über dies und das. Ich spürte, dass ich mich in jeden Einzelnen einklinken und ihre Sätze beenden konnte. Zudem war ich omnipräsent und wusste schon im Voraus, in welcher Stimmung meine Mitredner waren. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich wies jeden darauf hin, nicht zu sagen, was er gerade sagen wollte. Ich zog alle Fäden und verblüffte, indem ich alle dort abholte, wo sie gerade waren. Im Raum war ein Knistern und die Spannung war spürbar. Der eine Kollege wurde unruhig und ich dachte, dass genau er mir feindselig gesinnt war. Doch er verharrte in der Runde. Mir machten diese Stunden etwas Angst, kam es mir doch so vor, als hätte ich einen direkten Zugang zu den Gefühlen der anderen. Wieder war ich aufgefallen. Bald mal müsste ich Pascal aufsuchen und mit ihm darüber reden.
So vergingen noch ein paar Wochen, als ich eines Abends am See spazieren ging. Plötzlich hatte ich Lust, an holzigen Jalousien meine Schlagkraft zu testen. Wie ich es im Karate gelernt hatte, schlug ich mit meiner Faust und mit aller Kraft den Laden kaputt. Gleichzeitig spürte ich einen leichten Schmerz im kleinen Finger der rechten Hand. Innerhalb der nächsten Stunde schwoll dieser stark an, worauf ich ihn mit Eis kühlte. Weil nichts nützte, suchte ich am anderen Tag einen Arzt auf. Dieser eröffnete mir, der Finger sei dreifach gebrochen und er würde ihn sogleich gipsen. Ich tänzelte in der Praxis umher und erzählte ihm Witze. Meine Energie befand sich auf dem Höhepunkt. Er verpasste mir einen Gips vom Finger bis zum Ellbogen. Dann sagte ich zum Arzt: „Sehen Sie, ich habe überhaupt keine Schmerzen“, und schlug die rechte Hand mit aller Gewalt an die Wand. Der Gips zerfiel, worauf der Arzt ein kurzes Telefongespräch führte. Wenig später erschienen zwei Polizisten in der Praxis. Ich konnte es nicht fassen, dass sie meinetwegen gekommen waren, um mich zum Bezirksarzt zu begleiten. Dort fiel mir als Erstes die Arztgehilfin auf, mit der ich ein wenig flirtete. Auch sie war freundlich mit mir.
Der Doktor saß hinter seinem breiten Schreibtisch. Die Polizisten standen hinter mir. „Herr Hauser, Ihnen geht es nicht gut, wir müssen sie in die ‚Burg‘ einweisen.“ Ich war schockiert und aggressiv. „Nicht in die ‚Burg‘!“ Ich wusste ja vom ersten Mal, wie schmerzvoll ein Aufenthalt dort war. „Lass mich los, du Schwuler“, beschimpfte ich den Arzt. Dann wehrte ich mich gegen die Polizisten, bis sie mir die Handschellen anlegten.
9. Kapitel
Auf der Fahrt zur „Burg“ sagte ich kein Wort. Was würden wohl meine Mutter und meine Schwestern sagen? In der Zentrale der Klinik, als sie mich von den Handschellen befreiten, wehrte ich mich. Ich wollte nicht hier sein und so kämpfte ich mit den Polizisten, entriss dem einen das Funkgerät und trampelte auf ihm herum. Dem anderen riss ich die Brille vom Kopf und zerstörte sie. Nach einer Viertelstunde hatten sie mich überwältigt und würgten mich so lange, bis ich ohnmächtig wurde.
Aufgewacht bin ich dann schließlich in der geschlossenen Abteilung A2-A. Wo war ich nur hingeraten? Abgeschlossene Türen, wie damals bei Vater. Dabei war es mir doch so gut gegangen. Ich war optimistisch, energiegeladen und immer gut gelaunt. Ich konnte mich nicht erinnern, dass es mir schon mal so gut gegangen wäre. Nein, ich konnte nicht akzeptieren, hier zu sein! Noch befand ich mich auf einer Sitzgruppe im Eingangsbereich. Ich erschrak ob meinen Aggressionen und sah nur noch die Telefonkabine.
Ich wollte hier raus. Und sah nicht ein, warum ich festgehalten wurde. Schließlich fühlte ich mich gut, ich war kräftig und verstand nicht, warum ich in einer geschlossenen Abteilung sein musste. Mir kam mein Vater in den Sinn, und der war schon zehn Jahre eingesperrt. Musste ich dasselbe Schicksal erleiden?
Plötzlich ergriff ich die Tür der Telefonkabine und riss sie heraus. Ich verspürte unmenschliche Kräfte und begann die Seitenwände herauszureißen und in den Wohnraum zu schmettern. Nebenbei nahm ich wahr, dass alle Patienten von der Sitzgruppe flüchteten. Sogleich erfasste ich den Pingpong-Tisch und schleuderte ihn in die Ecke. Ich wollte nicht eingesperrt sein und war total aufgeregt und stark wie ein Stier. Ob des ganzen Kraftaktes war mir entgangen, dass ich von zwölf Pflegern umzingelt wurde. Alles nur Männer. Einer hatte eine Spritze in der Hand und versuchte, mich zu beruhigen. Doch ich war nicht fähig, ihm zuzuhören. Die Spritze machte mir Angst. Der Kreis begann sich zu schließen. Ich konzentrierte mich auf den Mann mit der Spritze. Mit ein paar Fußtritten hielt ich die Meute von mir fern. Aber die Übermacht war erdrückend und sie bekamen mich zu fassen. Viele Hände drückten mich zu Boden. In diesem Moment spürte ich einen brennenden Stich in meinem rechten Bein. Sofort trugen sie mich in ein Zimmer, das nur ein Bett aus Kunststoff enthielt und nichts anderes. In der Ecke stand eine Toilette. Abgeschlossen war der Raum mit einer zehn Zentimeter dicken Eichentüre. Später sagte man mir, das sei ein Isolierzimmer.
Sofort schlief ich ein. Als ich wieder aufwachte, brannte mein rechtes Bein, ich konnte es kaum bewegen. Noch nach drei Tagen spürte ich die Nachwirkungen der Spritze. Festgehalten zu werden und mit aller Gewalt eine Spritze verpasst zu bekommen, empfand ich als psychische Vergewaltigung. Wahrscheinlich hatte ich ihnen keine andere Wahl gelassen.
Eine Woche verbrachte ich in der sogenannten Loge. Wenn das Essen hereingeschoben wurde, musste ich auf dem Bett sitzen. Langsam wurde ich ruhiger und ich wusste, um hier herauszukommen, musste ich mich benehmen. Ich fühlte mich sehr einsam und war mir nicht bewusst, was mit mir nicht stimmte. Am achten Tag öffnete eine Pflegerin die Tür und sagte, ich könne herauskommen. Ich wollte brav sein und die Regeln befolgen. Die Einzelhaft hatte bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Sie zeigte mir ein normales Zweierzimmer. Alles war besser als die „Loge“. Es hatte Kästen und am Rand stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Am Fenster hingen Vorhänge. Wie war ich froh, der Isolation entkommen zu sein.
Meine Aggressionen waren kaum mehr spürbar. Sehr erleichtert begab ich mich zur Sitzgruppe, wo ein junger Mann mit einer schwarzen Lederjacke saß. Er hatte kurzes Haar und war von sehr kräftiger Statur. Er erzählte mir, er sei achtzehn Jahre alt und vor zwei Jahren in die „Burg“ gekommen. Ich dachte mir, dass dies doch kein Ort sei für Teenager. Wir unterhielten uns noch ein Weilchen. Sein Name sei Klaus, verriet er mir. In den nächsten Tagen freundeten wir uns an. Überhaupt kam man sich hier schneller näher, möglicherweise, weil niemand etwas zu verlieren hatte.
Als ich nochmals in die „Loge“ musste, durfte ich Farben mitnehmen. So fing ich an zu malen, viele Tage hintereinander und mit voller Hingabe. Meine Leinwand waren die vier Wände. Auf einer thronte ein riesiges Kreuz im Sonnenuntergang, auf einer zweiten eine Blumenwiese. Kein Fleck war unbemalt. Als die Tür wieder geöffnet wurde, wollten alle mein Gemälde sehen. Eine Völkerwanderung hatte eingesetzt. Die Pfleger sagten, dass die Wände erst weiß überstrichen würden, wenn ich die Isolierzelle nicht mehr brauche. Ich verspürte unglaubliche Kräfte, physisch und psychisch. Auf der Abteilung war ich der unumstrittene Chef. So einflussreich war ich bisher noch nie gewesen. Klaus saß ständig bei mir. Ich hatte großen Einfluss auf ihn. Obwohl er sich von niemandem etwas sagen ließ und genau wusste, was er wollte, spürte ich den großen Respekt, den er mir entgegenbrachte. Tagsüber arbeitete er auf einem Bauernhof, von wo er immer wieder Bratwürste, Eier oder Käse mitbrachte. Er bekam die Lebensmittel geschenkt und verkaufte sie auf der Abteilung. Er war ein guter Geschäftsmann und schlug aus allem Profit. Schon bald beherrschten wir zwei die Szene. Während ich alle Fäden zog, hielt Klaus mir den Rücken frei. Langweilig wurde mir nie. Ich hoffte, diese Kraft und diesen Optimismus nach draußen retten zu können.
Anderntags hatte ich einen Termin beim Arzt. Nach einem kurzen Gespräch eröffnete er mir schonungslos, dass ich an einer manisch-depressiven Erkrankung leide. Sollte meine gefühlte Stärke in der Tat nur eine Krankheit sein? Oder war das alles ein Betrug? Natürlich wusste ich selber, dass meine Verfassung nicht normal war, musste ich doch stets starke Medikamente schlucken. Manchmal schienen sich meine Kräfte durch diese Mittel noch zu verstärken. Ich wurde nachdenklich. Meine Krankheit hatte also einen Namen, aber ich wusste überhaupt nicht, was sie bedeutete und was ich gegen sie unternehmen konnte.
Auf der Abteilung stand ein Pingpong-Tisch, an dem hauptsächlich das Pflegepersonal – unglaublich gekonnt und profimäßig – spielte. Nicht weiter erstaunlich, angesichts der vielen Stunden Übung, die sie hatten. Auch ich liebte dieses Spiel und verbrachte viel Zeit damit.
Ab und zu durften wir einen Spaziergang machen. Wenn einer fluchtgefährdet war, musste er alleine mit dem Pfleger gehen. Die anderen in Gruppen. Die Umgebung war traumhaft. Das Essen wurde auf der Abteilung serviert. Ich empfand die Essenspause immer als eine Etappe des Tages. Manchmal konnte ich nicht gut schlafen. Dann begab ich mich in das Wohnzimmer. Meistens war noch jemand anders da. Die besten Gespräche fanden in diesem Rahmen statt. Ich empfand die Bekanntschaften als sehr ehrlich und voll von Vertrauen. Im Gegensatz zu „draußen“ schien man hier nicht so schnell eine Mauer aufzubauen.
Eines Tages eröffnete mir Klaus, er wisse, wo die Kasse der Ergotherapie aufbewahrt werde. Sie sei im Wohnraum in einem Kasten mit der Nummer zwölf untergebracht. Die Schrankwand bestand aus zwanzig kleinen Schränkchen. Nummer zwölf befand sich einen Meter zwanzig über dem Boden. Klaus flehte mich an, er brauche Geld. So startete ich einen gekonnten Fußtritt und das Türchen brach auseinander. Klaus ergriff die Kasse und rannte davon. Natürlich wurden wir erwischt. Der Arzt attestierte mir immer noch Aggressionen.
Einmal wurde eine junge Frau eingewiesen. Sie war extrem unruhig, sehr laut und aggressiv. Sie lief im Korridor umher und schrie unaufhörlich. Pascal war gerade bei mir auf Besuch. Als dann plötzlich fremde Pfleger zur Tür hereinplatzten und ich im Hintergrund einen Pfleger mit einer Spritze in der Hand sah, handelte ich schnell. Ich wollte der Frau unbedingt das traumatische Erlebnis der Zwangsspritzerei ersparen. So warf ich mich an die Frau heran, stieß einige Pfleger weg und schrie mit aller Kraft: „Sie kommt freiwillig in die Isolation!“ Dann führte ich sie noch nach hinten, wo sie auch blieb.
Die Pfleger zogen mitsamt der Spritze wieder ab. Pascal, der alles beobachtet hatte, fand das eine große Show. Ich glaube, er hatte auch ein wenig Angst.
Generell war ich zufrieden mit dem Pflegepersonal. Alle boten einem das Du an. Auch mit den Ärzten hatte ich keine Probleme. Langsam realisierte ich, dass mir hier geholfen wurde.
An einem regnerischen Mittag wurden wir alle ins Wohnzimmer gebeten. Der Oberarzt setzte mit ernster Stimme zu einer Bekanntmachung an; er habe uns eine traurige Mitteilung zu machen. Benjamin, ein Mitpatient von uns, sei heute Morgen unter den Zug gegangen. Sie boten uns ihre Hilfe an, für den Fall, dass wir reden wollten. Ich konnte die folgende Nacht nicht schlafen, hatten Benjamin und ich uns doch zwei Monate gekannt.
Eine Patientin war magersüchtig. Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen. Gehen konnte sie nicht mehr, sie kroch die Wände entlang. Ihre Augen quollen riesengroß aus den Augenhöhlen, was im Vergleich zum totenkopfähnlichen Gesicht surreal aussah. Im vollen Ernst behauptete sie immer, zu dick zu sein. Eines Tages holte sie ein Krankenwagen ab ins Spital, wo sie – so hörte ich – später starb.
Ich fühlte mich immer besser, die übermäßige Energie und die Aggressionen verschwanden. Mein Austritt stand kurz bevor. Langsam wurde ich nervös. Würden meine Mitarbeiter mich noch ernst nehmen? Oder meine Freunde und meine Familie? Und würde ich in der Arbeit bestehen? An einem sonnigen Freitag konnte ich austreten. Den Wohnort hatten wir ja inzwischen gewechselt, ich wohnte anfangs mit Mutter und Karin.
10. Kapitel
So fing ich wieder an zu arbeiten. Mein Chef eröffnete mir, dass er mir Stundenlohn bezahlen werde. Ich war gar nicht erfreut. Ich hatte doch schon genug gelitten, jetzt wurde ich noch bei der Entlohnung bestraft. Dazu kam, dass ich zwei Monate lang nur stundenweise arbeiten durfte. Der manische Schub hatte mich doch sehr geschwächt. Trotzdem war ich guter Dinge, ich hatte einen unglaublichen Trip erlebt, unbändige Energie gehabt und einen grenzenlosen Optimismus verspürt. Es sollte doch möglich sein, diesen Zustand in einer gesunden Phase zu erlangen.
In dieser Zeit traf ich in einem Restaurant auf die Arztgehilfin des Bezirksarztes, der mich eingewiesen hatte. Wir kamen ins Gespräch, sie verriet mir, dass sie Claudia heiße. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Wir verabredeten uns wieder und verliebten uns ineinander. Schon bald wohnte sie teilweise bei mir. Meine Mutter lebte wieder bei Gianni und Karin suchte sich etwas Eigenes. Man könnte sagen, dass es mir zeitweise recht gut ging. Trotzdem quälten mich manchmal Depressionen oder ich war sehr melancholisch. Auf diese Weise verhielt es sich etwa ein Jahr lang. Dann wurde ich plötzlich unruhig. Ich war so umtriebig und rastlos. Claudia machte sich Sorgen und tauschte sich mit Mutter aus. Mein Arzt verordnete mir mehr Medikamente und bestellte mich in kürzeren Intervallen zu sich.
Sollte nun alles wieder von vorne beginnen?
Als mein Arzt meinte, er müsse mich einweisen, bin ich abgehauen und habe mich im Wald versteckt. Ich wurde ausgeschrieben und von der Polizei gesucht. Erstmals fühlte ich mich verfolgt und ich wusste nicht mehr, was Realität und was Einbildung war. Später überfiel mich die Polizei zu Hause und führte mich in Handschellen ab. Was war nur mit mir los? Würde ich die Kraft haben, all das noch einmal durchzustehen?
So landete ich wieder in der „Burg“. Wieder wehrte ich mich, als ginge es ums Überleben, doch die Zwangsspritze blieb mir nicht erspart. Als ich in der Isolierzelle erwachte, fühlte ich mich unverwundbar. Nichts konnte mich aufhalten. Ich wollte hier raus, die Wände erdrückten mich. Je mehr Medikamente ich bekam, umso stärkere Kräfte spürte ich in mir. Dann habe ich ein paar Stunden meditiert und mich auf die dicke Holztüre konzentriert, welche, auf die ganze Höhe verteilt, mit drei Schlössern versehen war. Es folgten Dutzende von Fußtritten, mit aller Gewalt und gezielt auf das mittlere Schloss, so lange, bis die Türe aus der Verankerung sprang. Sie hing schräg und sofort kamen Pfleger angerannt. Ein Schreiner musste mit der Bohrmaschine die Türe bearbeiten und ich bekam eine neue. Ich fühlte mich unbesiegbar, war ich doch der Erste, der je aus der „Loge“ ausgebrochen war.
Auf der Abteilung befand sich noch ein anderer Maniker. Man kann sich nicht vorstellen, welche Unruhe herrscht, wenn zwei wie ich aufeinandertreffen. Einer musste ständig weggesperrt werden. Um uns herum war die Luft elektrisiert, Energie füllte den Raum.
Ich bekam sehr viele Medikamente. Während der Körper sich müde, ja fast wie gelähmt anfühlte, war der Geist hellwach und glasklar. Es kam mir vor, als hätte sich eine körpereigene Droge aktiviert. Dann lernte ich den knapp zwanzig Jahre älteren Bernhard kennen, der sehr gerne für seine Mitpatienten kochte, aber ein Alkoholproblem hatte. Er war mir sehr sympathisch. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Wenn ich Schmerzen hatte wegen der vielen Medikamente, spielte er mir auf dem Klavier vor. Auch Tina hing mit uns rum. Sie hatte die gleichen Probleme wie Bernhard.