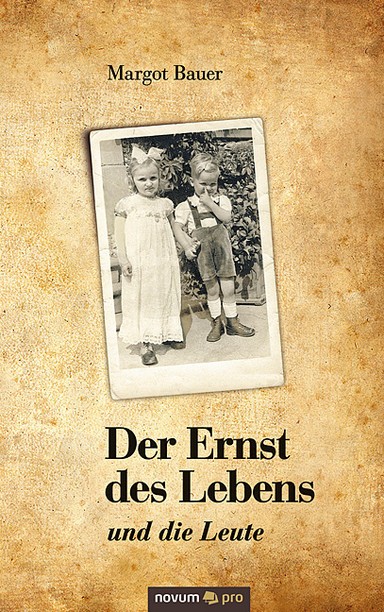Der Ernst des Lebens
und die Leute
Margot Bauer
EUR 19,90
EUR 11,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 212
ISBN: 978-3-99048-098-4
Erscheinungsdatum: 07.07.2015
Als Einzelkind einer Großfamilie, sucht Margot in der Nachkriegszeit innerhalb eines katholischen Dorfes zwischen Prüderie, Missverständnissen und archaischen Gepflogenheiten ihren Weg.
Am Waldrand.
Das Kind
steht nicht,
geht nicht,
sitzt bloß.
Hilflos.
Über die Wiese
geht
kindlos
die Mutter.
Über die Wiese
geht
haltlos
der Schrei.
Mutter geht.
Kind schreit.
Mutterlos,
endlos.
Trostlos.
Als ich drei Jahre alt war, kannte ich diesen Traum bereits seit Langem. Ich träumte ihn immer wieder. Er war schrecklich. Ich war klein in diesem Traum und noch unfähig, meine Beine zu gebrauchen. Zurückgelassen, konnte ich lange nicht aufhören zu schreien. Ich schrie im Traum. Ich schrie, wenn ich erwachte. Ich schrie noch lange, nachdem ich aufgewacht war und jemand mich in den Armen hielt und versuchte, mich zu beruhigen. Irgendwann blieb er aus, der Traum. Vergessen habe ich ihn nie.
– Biblische Gesetze –
Neues Testament:
Kolosser, Kapitel 3, Vers 18
„Ihr Frauen seid den Männern untertan, wie es sich schickt im Herrn.“
Alle nahmen sie ernst, die Bibel, die Mannsleute von der Mosel. Sogar sinnreiche Erweiterungen erfuhren die biblischen Lehren darüber hinaus. Vermutlich steht’s sogar auch irgendwo geschrieben, dass ein Mann niemals auf die Worte seiner Frau hören soll. Zumindest war das genau so ein stets gern und zuverlässig befolgtes Gebot der gottesfürchtigen Moselkerls, sogar bei denen, deren Füße selten den Weg in die Kirche fanden.
Was vielleicht nirgendwo geschrieben steht, aber dennoch als außerordentlich wirksames Gesetz moselauf und moselab – vielleicht auch anderswo? – gnadenlose Gültigkeit erlangte, war, dass die männlichen Mitbürger von Jugend auf Trinkfestigkeit zu trainieren hatten. Zumindest dann, wenn sie irgendwann von echten Männern als echte Männer anerkannt sein wollten.
– Das Thanischten-Haus –
Häuser hatten Namen. Häuser vererbten ihren Namen.
Sie hießen nach dem Bauherrn, der sie einst errichten ließ und darin das künftige Geschlecht begründete. Das Haus übertrug seinen Namen auf alle nachfolgenden Generationen, ungeachtet der Tatsache, unter welchen Geschlechternamen diese im Taufbuch geführt wurden. Auch nach einem Handwerk, das in einem Hause ausgeübt wurde, nach seiner Situation im Gelände, nach seinem Platz in der Gemeinschaft mit anderen Menschen oder Bauten des Ortes oder auch nach einer Begebenheit, welche sich in einem Hause zugetragen hatte, konnten Häuser benamt sein. Namenlose Häuser waren im Ort unbekannt oder so neu, dass sie sich noch keinen Namen verdient hatten.
Schiffbasten hießen die Leute aus dem Hause, nach dessen Gründervater mit dem Namen Sebastian die Wohnstatt getauft war. Sebastian war ein Mann, der damit Geld verdiente, dass er, gemeinsam mit anderen starken Kerlen, auf dem Leinpfad an langen Tauen (manchmal auch mit Unterstützung von Pferden) Schiffe die Mosel aufwärtszog (treidelte). Die Leute, die in dieses Haus hineingeboren wurden, trugen über ihr zeitliches Dasein hinaus den Namen Schiffbasten als den im Dorf gebräuchlichen Nachnamen. Diese individuellen Übernamen waren auch hinsichtlich der Unterscheidung verschiedener Familien hilfreich, die in vielen Fällen den gleichen amtlichen Nachnamen trugen.
Solange sie Bürger derselben Ortschaft waren, wurde den dem Namensgeber nachfolgenden Familienmitgliedern bei räumlicher Veränderung zur besseren Unterscheidung von den am ursprünglichen Platze Verbliebenen eine Eigentümlichkeit des neuen Zuhauses beigefügt. Sie hießen dann vielleicht Oberschiffbasten, wenn sie etwa im Oberdorf, oder Stooadschiffbasten, wenn sie am Gestade, dem Moselufer, Wohnung genommen hatten.
Zur Kenntlichmachung der Individuen waren damals, als den Leuten weder orthopädische noch kosmetische Korrekturmöglichkeiten zur Verfügung standen, auch die physiognomischen Eigentümlichkeiten einer Persönlichkeit von Nutzen. Ja, sogar hygienische Besonderheiten – wie beispielsweise Rotznasen – dienten der das Leben überdauernden Identifizierung der Mitbürger.
Das Bruchsteinhaus aus Moselschiefer mit den Fenstereinfassungen aus rotem Sandstein und seinen hohen Räumen lag an der Hauptstraße im Oberdorf. Es war von Wildem Wein überwachsen, der bereits das hohe Dach erklommen hatte und der, wenn er blühte, nach Honig duftete und eine Menge winziger, gelblicher Blütenreste abwarf. Darauf stürzten sich die Ameisen, welche an seinen Wurzelstöcken, links und rechts der ausgetretenen Sandsteinstufen, ihre Nester hatten. Eifrig trugen sie davon Häufchen zusammen, wenn die Sonne schien, während andere, wahrscheinlich die Ameisen-Hebammen, sich damit beschäftigten, die blassen Puppen ihrer Königin hin und her zu schaffen.
Die zweiflügelige Pforte, welche man über die Treppe erreichte, war ein Stück ins Hausinnere versetzt und verschlossen. Wenn die Sonne diesen kleinen Platz erwärmte, duftete das dunkle Eichenholz säuerlich und ein wenig bitter. Eiserne Löwenköpfe schmückten die Türklinken. Das Kind aus diesem Hause hatte die Gewohnheit, an allem zu riechen, und Gerüche prägten sich ihm unauslöschlich ein. Sonnenerwärmtes Eisen roch anders als kaltes. Es roch ein wenig wie Blut.
Zwischen großen Hortensienbüschen, die links und rechts der Treppe in großen Kübeln gediehen, nahmen gerne Personen Aufstellung, die fotografiert werden wollten, wenn sie für eine Hochzeit oder eine Kindstaufe geschmückt waren oder weil man ein Abschiedsfoto machen musste. Hortensien riechen grün, egal, ob sie rosa, weiß oder blau blühen.
Zwei Oberlichte über dem Haupteingang waren aus grünem Glas und wurden von traubenbehangenen Weinreben umrankt, die aus Holz geschnitzt waren. Dahinter dämmerte der breite Flur und der raumhohe Spiegel starrte angsterregend hinein. Nie konnte man sicher sein, wer im Düster aus ihm herausschauen würde, wenn man daran vorbeikam.
„Hinter dem Spiegel steckt der Teufel“, sagten die Großen und meinten damit alle Spiegel. Aber gerade dieser riesige Spiegel schien die ihm gemäße Herberge zu sein.
Licht fand hinter den mächtigen Mauern des Hauses wenig Raum. Es wurde gefürchtet, denn es verfügte über Kräfte, die hier unerwünscht waren. Es machte die Gardinen morsch, es bleichte die Tapeten und Möbelpolster aus. Wenn Sonnenlicht schräg durch eine Fensterscheibe fiel, war die Lichtflut von – sonst unsichtbarem Leben – erfüllt. In ihm wogten Myriaden feinster Partikelchen. So einen einsamen Lichtstrahl im sonst abgedunkelten Raum suchten die Fliegen gerne auf, um darin mit dem Staub zusammen ihren Sonnentanz zu feiern. Um solch unliebsame Erscheinungen zu bannen, gab es im oberen Stockwerk an der Innenseite der Fenster tapetenkaschierte Klappläden, mit denen man diesem Unfug Einhalt gebieten konnte.
Im Parterre befand sich das gute Zimmer, welches immer an Weihnachten und einmal im Februar, wenn Kirmes war, geheizt wurde. Das übrige Jahr blieb es, mit Ausnahme von Jubiläen und anderen Familienfesten, versperrt. Natürlich waren hier bis auf jene feierlichen Ausnahmen die Jalousien heruntergelassen. Der besondere Geruch dieser Stube blieb auf diese Weise wunderbar konserviert. Er entströmte der geschlossenen Gesellschaft der guten Sachen, die hier versammelt waren.
Das Sofa, im erdfarbenen, groß geblümten Plüsch, dominierte die übrigen Düfte. Aus ihm dünstete der in ihm gefangenen Staub, der sich mischte mit den Gerüchen, welche vom Besessenwerden durch Gesäße zweier Generationen herrührte. Anders roch das honigfarbene Eichenholz des Zylinderbureaus. Ein imposanter Schreibtisch, der von einem Rollladen im Radius eines Viertelzylinders verschlossen war. Öffnete man ihn, was während der Aufenthalte in diesem Raum regelmäßig geschah, weil sich das Fotoalbum darin befand, roch es nach Papier und anderen geheimnisvollen Dingen, wie zum Beispiel das Stempelkissen eines war. Der große, runde Tisch mit der weit herabhängenden Fransendecke, unter dem das Kind sich gerne aufhielt, wenn in der Stube etwas los war, roch äußerlich ähnlich wie das Vertiko aus Nussbaum, das ein Meisterstück war vom Schreiner Karl. Wenn jedoch die Türen dieses Prunkstücks sich auftaten, entließ es ein ganz eigenes Aroma! Das musste von den Schätzen herrühren, die darin verwahrt wurden, das gute Geschirr, gehäkelte Spitzendeckchen, eine Schachtel mit Feldpostbriefen, die Treveris-Gläser und alt gewordene Weihnachtsplätzchen in einer schmucklosen, hohen Blechdose.
Zwei weinrot bezogene Polstersessel waren Gesellschafter des Rauchtisches. Der hieß so, weil sich auf einem runden Häkeldeckchen ein Aschenbecher, eine Kerze und ein Streichholzschachtelhalter versammelt hielten. Das Haus benötigte jedoch keinen solchen. Er war reiner Luxus, denn geraucht wurde überall. Darüber hing dort an der Wand ein Regulator, den jedes Mal, bevor die Stube in Betrieb genommen wurde, der Köbes eigenhändig und mit Bedacht aufzog, wobei er die Anzahl der Glockenschläge mit der Ziffer, auf welche der kleine Zeiger wies, in Übereinstimmung zu bringen hatte. Viele Male ertönte dann der Gong, bis alle Stunden durchgezählt und mit dem gegenwärtigen Augenblick im Einklang waren. Alle Feierlichkeiten im Hause wurden auf diese Weise eingeläutet. Im schmalen Holzrähmchen hing dort an der Wand eine ausgeblichene Schwarz-Weiß-Fotografie, das Bild einer alten Frau. Das sei die Uroma, hatte man dem Kind gesagt, weshalb es lange Zeit annahm, die alte Frau darauf mit dem Strickzeug in den knorpeligen Händen, welche sich im Schoß ihrer gestreiften Schürze niedergelassen hatten, werde so geheißen, weil sie gerade unter der Uhr ihren Platz hatte. Die Uroma war in das Frühmesser-Haus geboren worden. Das hatte ihr von der Untermosel eingewanderter Vater von der Gemeinde erworben. Frühmesser-Haus hieß es, weil dort die pensionierten Dorfgeistlichen einwohnten, die auf ihre alten Tage die überschaubare Aufgabe innehatten, sonntags die Frühmesse zu lesen. Die Ur-Trina soll, kurze Zeit nachdem das Kind auf die Welt gekommen war, verstorben sein. Sie war die Mutter von Trina und ihren drei Geschwistern. Die Trina-Tochter, Trina war die Großmutter des Kindes, dessen Mutter Trinschi hieß, demnach die kleine Trina war. Gelegentlich hörte das Mädchen die Erwachsenen darüber reden, was die Uroma doch für ein guter Mensch gewesen sei, weshalb es oft, beim Anblick ihres Bildes, ein bisschen traurig wurde darüber, dass sie nicht mehr da war. Und dann versuchte es, sich auszumalen, wie es wäre, wenn sie dort in einem der weinroten Sessel sitzen würde, und wie die Schürze riechen würde, die es sich dabei in den Farben Blau und Weiß erträumte. Als das Kind eines Tages erfuhr, dass ein Gebet, welches bei einem bösen Gewitter aufzusagen war, von ihr stamme und das „Den Schaffer lass’ schaffen, den Schlafer lass’ schlafen, den Esser schlag tot“ lautete, wurde die alte Frau auf dem Foto ihm aufs Neue missverständlich.
Im Verlaufe seiner Kinderjahre musste es sich immer wieder Gedanken darüber machen, auf welche Weise diese beiden überlieferten Mitteilungen miteinander in ein plausibles Verhältnis zu bringen seien. Solcherart oder andere sich widersprechende Mitteilungen oder Beobachtungen häuften sich mit der Zeit.
Im Erdgeschoss gab es noch zwei weitere verriegelte Türen. Hinter einer befand sich das „Dunkelzimmer“. Da blieben – weil seit dem Bombenfall die zerborstenen Fensterscheiben noch nicht ersetzt worden waren – die Rollläden lange Zeit heruntergelassen. Diese Tür tat sich gelegentlich auf, um irgendein nichtsnutzig gewordenes Stück hindurchzulassen, welches sich dann zu dem dort bereits ansässig gewordenen Plunder gesellte. Die andere Tür führte in die ehemalige Schmiede, die an der Außenwand, über den Hof des Hauses, noch einen weiteren Zugang besaß.
Eine gefährlich blank polierte, dunkle Eichentreppe stieg in den ersten Stock hinauf. Oben gab es ein Bad und eine Toilette mit Wasserspülung, eine Neuerung, die der Anton eingeführt hatte als verspäteter Einstand in das schwiegerelterliche Haus. Pakete mit Steinzeugfliesen lagen herum während der Zeit, als die nötigen Zubauten in der ehemals geräumigen Diele erstellt wurden. Erst zusammengefügt erklärten sich die Ornamente, die das Kind darauf zu entziffern versucht hatte. Eine Schlinge im Eck des einzelnen Quadrats fand sich mit den Ecken anderer Platten zu einer Art Blüte zusammen. Schiefergrau, Lehm und Rost waren die Farben.
Der Köbes vermisste das abhandengekommene Häuschen neben dem Schweinestall mit dem ausgeschnittenen Herz in der rohen Brettertür. Noch viele Jahre konnte man hören, wie er nachts, an den Schlafzimmern vorbei, das Klosett mit Wasserspülung links liegen ließ und hinunter hinters Haus tappte. Dort, an dem Platz, wo einmal neben dem Misthaufen der Abtritt gewesen war, hatte er frische Luft um die Nase, während er mit dem Urinstrahl auf den eisernen Rost am Boden zielte, unter dem er die Jauchegrube wusste. Je nachdem, wie der Mond sich dabei zeigte, konnte er dann am nächsten Tag Vorhersagen über das zu erwartende Wetter machen.
Ein langer Gang verband jetzt die Zimmer dieser Ebene mit der Treppe und die hohe Christusfigur, die in einer Nische auf der großen Kommode ihren Platz hatte und zu deren Füßen links und rechts zwei gegengleiche „Schlafende Johannes“ ausharrten, darbte seither im Finstern. Bis auf Fronleichnam. Dann wurde der Herr Jesus, der mit zwei Fingern seiner rechten Hand auf sein brennendes Herz deutete, welches er außen auf dem weißen Hemd trug, zusammen mit den Johannes-Zwillingen gewaschen und unten in der Nische vor dem Portal aufgebaut. Von dort aus konnten sie auf die Girlanden schauen, die von allen Familien des Dorfes am Vortag geknüpft worden waren und die Prozessionswege säumten. Oder, wenn es so weit war, die vorbeiziehende Prozession betrachten, zwischen dunkelroten Pfingstrosen hervor, die trotz aller Pracht bitter grün rochen, und Lupinen, die sich in ihrem samtig bitteren Duft immer nach der Form der Vase verbogen, in der sie steckten.
Das Kind, dem eine besondere Neigung zum Beobachten und ein heftiges Verlangen nach Verstehen eigen waren, nutzte diese Gelegenheit, des Herrn Jesu Antlitz zu studieren, wenn es ihm nun, einmal im Jahr, von Angesicht zu Angesicht begegnen konnte. Da fühlte es sich eigentümlich getröstet, dass unser Herr – trotz des nackten Herzens außen, so ungeschützt auf dem langen Hemd, und allem, was ihm sonst schon widerfahren war – so nachsichtig guckte, während die beiden Johannesse einfach alles verschliefen.
Langeweile war dem Kinde fremd. Immer gab es Ungereimtes zu reimen, planvoll Scheinendes nach wahrer Bedeutung zu durchsuchen, Fragmente aufzulesen, Lückenhaftes zu ergänzen und mit dem bisher Verstandenen sinnvoll zu verbinden. Zwei Onkel, eine Tante, Oma und Opa, Mutter und Vater waren schon für sich allein schwer verständlich. Erst recht im Zusammenleben unter diesem einen Dach gaben sie ausreichend Anlass zu Forschungen.
Bis auf den Vater und Trina schafften alle Mitglieder des Hauses gemeinsam auf den Feldern, in Garten und Stall und in den Weinbergen. Von Trina, der Oma des Kindes, die von ihm, wie von allen Übrigen im Hause, Mama genannt wurde, stammte die Auffassung, zu den besseren Leuten zu gehören. Vielleicht wurde deshalb allein ihr niemals richtige Arbeit zugemutet. Sie wurde wie eine Prinzessin gehalten, stand, durch wohlgeplättete Trägerschürzen vor Schmutz und schlechtem Ansehen geschützt, ihrem Hausstand vor und führte ein bisschen Regie in der Küche. Ihr war es vorbehalten, aus dem köstlichen Rahm, der die Woche über gesammelt wurde, eigenhändig die Butter zu bereiten. Natürlich war die Qualität dieser Butter der anderer Bauern weit überlegen. Der Buttertag war auch der Tag, an dem Trina nach dem Buttern aus einer Schublade im Küchenschrank den Packen Tageszeitungen der vergangenen Woche hervorzog. Den legte sie vor sich hin auf den Küchentisch, setzte sich dazu und begann damit, ihn mithilfe des großen Bratenwenders zu zerteilen. Erst wurden die Zeitungen, die ja bereits zur Hälfte zusammengefaltet übereinanderlagen, mit der Metallklinge dem Kniff entlang zertrennt. Dann wurden die Zeitungshälften erneut gefaltet und die Spalterei schritt fort, bis alle Blätter einen netten Papierstapel in handlicher Größe bildeten. Mit diesem wurde dann der Emaillebehälter mit der Aufschrift „Zwiebeln“ in der Toilette aufgefüllt. Danach setzte Trina einen frisch gefüllten Wasserkessel auf den Kohleherd und sich selbst auf einen Stuhl daneben, die Kaffeemühle zwischen die Knie geklemmt. Vielversprechend quietschte die Kurbel und der Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen zog durch die Küche. Bald klopfte es an der Tür, denn es war Mittwoch. Buttern, Klopapier zurechtmachen und der Besuch von Trinas Schwester Lena aus dem Nachbarhaus bedeuteten, dass die Hälfte der Arbeitswoche erreicht war.
Die Küche ist der Lebensraum des Hauses. Das wissen auch alle Fliegen. Sogar den Winter überlebten einige dort. Hoch oben an der Zimmerdecke hatten sie es dann weder mit dem Putzen der Flügel noch den ihnen sonst eigenen Geschäften besonders eilig. Im Sommer bevölkerte eine große Fliegenbande die Küchendecke und war dort wichtig unterwegs. Geschäftig eilten sie hier und da hin, stürzten sich in die Luft darunter und landeten durch die Kraft eines kleinen Purzelbaums wieder mit den Füßen an der Decke. Das Kind sah ihnen gerne zu und versuchte oft, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn es selbst dort oben an der Küchendecke herumspazieren könnte. Es dachte öfter darüber nach, ob die Fliegen eigentlich wussten, wo oben und unten ist. In jedem Sommer gab es einen Tag, an dem zu viele Fliegen in der Milch schwammen, die auf dem Kohleherd in einem großen Topf erhitzt werden musste, damit sie länger süß blieb. An diesem Tag besuchte Trina ihre Schwester, die nebenan wohnte und einen kleinen Laden hatte, wo die wichtigsten Dinge eines ländlichen Haushalts erworben werden konnten. Dort tranken die Schwestern in der Küche einen Kaffee. Die schmalen, dunklen Holzdielen dort wurden samstags immer mit Magermilch aufgewischt. Ein spezieller, säuerlicher Geruch hielt sich die ganze Woche über bis zur nächsten Anwendung. Trina kam dann mit drei Fliegenfängern zurück. Mit einem schmatzenden Geräusch entwickelten sich honigfarbene, glänzende Schillerlocken, wenn man die Fliegenfalle an einem roten Bändchen aus der kleinen Hülse zog. Sie rochen süßlich mit einem tückischen, ein wenig bitteren Duft im Hintergrund.
Das Kind
steht nicht,
geht nicht,
sitzt bloß.
Hilflos.
Über die Wiese
geht
kindlos
die Mutter.
Über die Wiese
geht
haltlos
der Schrei.
Mutter geht.
Kind schreit.
Mutterlos,
endlos.
Trostlos.
Als ich drei Jahre alt war, kannte ich diesen Traum bereits seit Langem. Ich träumte ihn immer wieder. Er war schrecklich. Ich war klein in diesem Traum und noch unfähig, meine Beine zu gebrauchen. Zurückgelassen, konnte ich lange nicht aufhören zu schreien. Ich schrie im Traum. Ich schrie, wenn ich erwachte. Ich schrie noch lange, nachdem ich aufgewacht war und jemand mich in den Armen hielt und versuchte, mich zu beruhigen. Irgendwann blieb er aus, der Traum. Vergessen habe ich ihn nie.
– Biblische Gesetze –
Neues Testament:
Kolosser, Kapitel 3, Vers 18
„Ihr Frauen seid den Männern untertan, wie es sich schickt im Herrn.“
Alle nahmen sie ernst, die Bibel, die Mannsleute von der Mosel. Sogar sinnreiche Erweiterungen erfuhren die biblischen Lehren darüber hinaus. Vermutlich steht’s sogar auch irgendwo geschrieben, dass ein Mann niemals auf die Worte seiner Frau hören soll. Zumindest war das genau so ein stets gern und zuverlässig befolgtes Gebot der gottesfürchtigen Moselkerls, sogar bei denen, deren Füße selten den Weg in die Kirche fanden.
Was vielleicht nirgendwo geschrieben steht, aber dennoch als außerordentlich wirksames Gesetz moselauf und moselab – vielleicht auch anderswo? – gnadenlose Gültigkeit erlangte, war, dass die männlichen Mitbürger von Jugend auf Trinkfestigkeit zu trainieren hatten. Zumindest dann, wenn sie irgendwann von echten Männern als echte Männer anerkannt sein wollten.
– Das Thanischten-Haus –
Häuser hatten Namen. Häuser vererbten ihren Namen.
Sie hießen nach dem Bauherrn, der sie einst errichten ließ und darin das künftige Geschlecht begründete. Das Haus übertrug seinen Namen auf alle nachfolgenden Generationen, ungeachtet der Tatsache, unter welchen Geschlechternamen diese im Taufbuch geführt wurden. Auch nach einem Handwerk, das in einem Hause ausgeübt wurde, nach seiner Situation im Gelände, nach seinem Platz in der Gemeinschaft mit anderen Menschen oder Bauten des Ortes oder auch nach einer Begebenheit, welche sich in einem Hause zugetragen hatte, konnten Häuser benamt sein. Namenlose Häuser waren im Ort unbekannt oder so neu, dass sie sich noch keinen Namen verdient hatten.
Schiffbasten hießen die Leute aus dem Hause, nach dessen Gründervater mit dem Namen Sebastian die Wohnstatt getauft war. Sebastian war ein Mann, der damit Geld verdiente, dass er, gemeinsam mit anderen starken Kerlen, auf dem Leinpfad an langen Tauen (manchmal auch mit Unterstützung von Pferden) Schiffe die Mosel aufwärtszog (treidelte). Die Leute, die in dieses Haus hineingeboren wurden, trugen über ihr zeitliches Dasein hinaus den Namen Schiffbasten als den im Dorf gebräuchlichen Nachnamen. Diese individuellen Übernamen waren auch hinsichtlich der Unterscheidung verschiedener Familien hilfreich, die in vielen Fällen den gleichen amtlichen Nachnamen trugen.
Solange sie Bürger derselben Ortschaft waren, wurde den dem Namensgeber nachfolgenden Familienmitgliedern bei räumlicher Veränderung zur besseren Unterscheidung von den am ursprünglichen Platze Verbliebenen eine Eigentümlichkeit des neuen Zuhauses beigefügt. Sie hießen dann vielleicht Oberschiffbasten, wenn sie etwa im Oberdorf, oder Stooadschiffbasten, wenn sie am Gestade, dem Moselufer, Wohnung genommen hatten.
Zur Kenntlichmachung der Individuen waren damals, als den Leuten weder orthopädische noch kosmetische Korrekturmöglichkeiten zur Verfügung standen, auch die physiognomischen Eigentümlichkeiten einer Persönlichkeit von Nutzen. Ja, sogar hygienische Besonderheiten – wie beispielsweise Rotznasen – dienten der das Leben überdauernden Identifizierung der Mitbürger.
Das Bruchsteinhaus aus Moselschiefer mit den Fenstereinfassungen aus rotem Sandstein und seinen hohen Räumen lag an der Hauptstraße im Oberdorf. Es war von Wildem Wein überwachsen, der bereits das hohe Dach erklommen hatte und der, wenn er blühte, nach Honig duftete und eine Menge winziger, gelblicher Blütenreste abwarf. Darauf stürzten sich die Ameisen, welche an seinen Wurzelstöcken, links und rechts der ausgetretenen Sandsteinstufen, ihre Nester hatten. Eifrig trugen sie davon Häufchen zusammen, wenn die Sonne schien, während andere, wahrscheinlich die Ameisen-Hebammen, sich damit beschäftigten, die blassen Puppen ihrer Königin hin und her zu schaffen.
Die zweiflügelige Pforte, welche man über die Treppe erreichte, war ein Stück ins Hausinnere versetzt und verschlossen. Wenn die Sonne diesen kleinen Platz erwärmte, duftete das dunkle Eichenholz säuerlich und ein wenig bitter. Eiserne Löwenköpfe schmückten die Türklinken. Das Kind aus diesem Hause hatte die Gewohnheit, an allem zu riechen, und Gerüche prägten sich ihm unauslöschlich ein. Sonnenerwärmtes Eisen roch anders als kaltes. Es roch ein wenig wie Blut.
Zwischen großen Hortensienbüschen, die links und rechts der Treppe in großen Kübeln gediehen, nahmen gerne Personen Aufstellung, die fotografiert werden wollten, wenn sie für eine Hochzeit oder eine Kindstaufe geschmückt waren oder weil man ein Abschiedsfoto machen musste. Hortensien riechen grün, egal, ob sie rosa, weiß oder blau blühen.
Zwei Oberlichte über dem Haupteingang waren aus grünem Glas und wurden von traubenbehangenen Weinreben umrankt, die aus Holz geschnitzt waren. Dahinter dämmerte der breite Flur und der raumhohe Spiegel starrte angsterregend hinein. Nie konnte man sicher sein, wer im Düster aus ihm herausschauen würde, wenn man daran vorbeikam.
„Hinter dem Spiegel steckt der Teufel“, sagten die Großen und meinten damit alle Spiegel. Aber gerade dieser riesige Spiegel schien die ihm gemäße Herberge zu sein.
Licht fand hinter den mächtigen Mauern des Hauses wenig Raum. Es wurde gefürchtet, denn es verfügte über Kräfte, die hier unerwünscht waren. Es machte die Gardinen morsch, es bleichte die Tapeten und Möbelpolster aus. Wenn Sonnenlicht schräg durch eine Fensterscheibe fiel, war die Lichtflut von – sonst unsichtbarem Leben – erfüllt. In ihm wogten Myriaden feinster Partikelchen. So einen einsamen Lichtstrahl im sonst abgedunkelten Raum suchten die Fliegen gerne auf, um darin mit dem Staub zusammen ihren Sonnentanz zu feiern. Um solch unliebsame Erscheinungen zu bannen, gab es im oberen Stockwerk an der Innenseite der Fenster tapetenkaschierte Klappläden, mit denen man diesem Unfug Einhalt gebieten konnte.
Im Parterre befand sich das gute Zimmer, welches immer an Weihnachten und einmal im Februar, wenn Kirmes war, geheizt wurde. Das übrige Jahr blieb es, mit Ausnahme von Jubiläen und anderen Familienfesten, versperrt. Natürlich waren hier bis auf jene feierlichen Ausnahmen die Jalousien heruntergelassen. Der besondere Geruch dieser Stube blieb auf diese Weise wunderbar konserviert. Er entströmte der geschlossenen Gesellschaft der guten Sachen, die hier versammelt waren.
Das Sofa, im erdfarbenen, groß geblümten Plüsch, dominierte die übrigen Düfte. Aus ihm dünstete der in ihm gefangenen Staub, der sich mischte mit den Gerüchen, welche vom Besessenwerden durch Gesäße zweier Generationen herrührte. Anders roch das honigfarbene Eichenholz des Zylinderbureaus. Ein imposanter Schreibtisch, der von einem Rollladen im Radius eines Viertelzylinders verschlossen war. Öffnete man ihn, was während der Aufenthalte in diesem Raum regelmäßig geschah, weil sich das Fotoalbum darin befand, roch es nach Papier und anderen geheimnisvollen Dingen, wie zum Beispiel das Stempelkissen eines war. Der große, runde Tisch mit der weit herabhängenden Fransendecke, unter dem das Kind sich gerne aufhielt, wenn in der Stube etwas los war, roch äußerlich ähnlich wie das Vertiko aus Nussbaum, das ein Meisterstück war vom Schreiner Karl. Wenn jedoch die Türen dieses Prunkstücks sich auftaten, entließ es ein ganz eigenes Aroma! Das musste von den Schätzen herrühren, die darin verwahrt wurden, das gute Geschirr, gehäkelte Spitzendeckchen, eine Schachtel mit Feldpostbriefen, die Treveris-Gläser und alt gewordene Weihnachtsplätzchen in einer schmucklosen, hohen Blechdose.
Zwei weinrot bezogene Polstersessel waren Gesellschafter des Rauchtisches. Der hieß so, weil sich auf einem runden Häkeldeckchen ein Aschenbecher, eine Kerze und ein Streichholzschachtelhalter versammelt hielten. Das Haus benötigte jedoch keinen solchen. Er war reiner Luxus, denn geraucht wurde überall. Darüber hing dort an der Wand ein Regulator, den jedes Mal, bevor die Stube in Betrieb genommen wurde, der Köbes eigenhändig und mit Bedacht aufzog, wobei er die Anzahl der Glockenschläge mit der Ziffer, auf welche der kleine Zeiger wies, in Übereinstimmung zu bringen hatte. Viele Male ertönte dann der Gong, bis alle Stunden durchgezählt und mit dem gegenwärtigen Augenblick im Einklang waren. Alle Feierlichkeiten im Hause wurden auf diese Weise eingeläutet. Im schmalen Holzrähmchen hing dort an der Wand eine ausgeblichene Schwarz-Weiß-Fotografie, das Bild einer alten Frau. Das sei die Uroma, hatte man dem Kind gesagt, weshalb es lange Zeit annahm, die alte Frau darauf mit dem Strickzeug in den knorpeligen Händen, welche sich im Schoß ihrer gestreiften Schürze niedergelassen hatten, werde so geheißen, weil sie gerade unter der Uhr ihren Platz hatte. Die Uroma war in das Frühmesser-Haus geboren worden. Das hatte ihr von der Untermosel eingewanderter Vater von der Gemeinde erworben. Frühmesser-Haus hieß es, weil dort die pensionierten Dorfgeistlichen einwohnten, die auf ihre alten Tage die überschaubare Aufgabe innehatten, sonntags die Frühmesse zu lesen. Die Ur-Trina soll, kurze Zeit nachdem das Kind auf die Welt gekommen war, verstorben sein. Sie war die Mutter von Trina und ihren drei Geschwistern. Die Trina-Tochter, Trina war die Großmutter des Kindes, dessen Mutter Trinschi hieß, demnach die kleine Trina war. Gelegentlich hörte das Mädchen die Erwachsenen darüber reden, was die Uroma doch für ein guter Mensch gewesen sei, weshalb es oft, beim Anblick ihres Bildes, ein bisschen traurig wurde darüber, dass sie nicht mehr da war. Und dann versuchte es, sich auszumalen, wie es wäre, wenn sie dort in einem der weinroten Sessel sitzen würde, und wie die Schürze riechen würde, die es sich dabei in den Farben Blau und Weiß erträumte. Als das Kind eines Tages erfuhr, dass ein Gebet, welches bei einem bösen Gewitter aufzusagen war, von ihr stamme und das „Den Schaffer lass’ schaffen, den Schlafer lass’ schlafen, den Esser schlag tot“ lautete, wurde die alte Frau auf dem Foto ihm aufs Neue missverständlich.
Im Verlaufe seiner Kinderjahre musste es sich immer wieder Gedanken darüber machen, auf welche Weise diese beiden überlieferten Mitteilungen miteinander in ein plausibles Verhältnis zu bringen seien. Solcherart oder andere sich widersprechende Mitteilungen oder Beobachtungen häuften sich mit der Zeit.
Im Erdgeschoss gab es noch zwei weitere verriegelte Türen. Hinter einer befand sich das „Dunkelzimmer“. Da blieben – weil seit dem Bombenfall die zerborstenen Fensterscheiben noch nicht ersetzt worden waren – die Rollläden lange Zeit heruntergelassen. Diese Tür tat sich gelegentlich auf, um irgendein nichtsnutzig gewordenes Stück hindurchzulassen, welches sich dann zu dem dort bereits ansässig gewordenen Plunder gesellte. Die andere Tür führte in die ehemalige Schmiede, die an der Außenwand, über den Hof des Hauses, noch einen weiteren Zugang besaß.
Eine gefährlich blank polierte, dunkle Eichentreppe stieg in den ersten Stock hinauf. Oben gab es ein Bad und eine Toilette mit Wasserspülung, eine Neuerung, die der Anton eingeführt hatte als verspäteter Einstand in das schwiegerelterliche Haus. Pakete mit Steinzeugfliesen lagen herum während der Zeit, als die nötigen Zubauten in der ehemals geräumigen Diele erstellt wurden. Erst zusammengefügt erklärten sich die Ornamente, die das Kind darauf zu entziffern versucht hatte. Eine Schlinge im Eck des einzelnen Quadrats fand sich mit den Ecken anderer Platten zu einer Art Blüte zusammen. Schiefergrau, Lehm und Rost waren die Farben.
Der Köbes vermisste das abhandengekommene Häuschen neben dem Schweinestall mit dem ausgeschnittenen Herz in der rohen Brettertür. Noch viele Jahre konnte man hören, wie er nachts, an den Schlafzimmern vorbei, das Klosett mit Wasserspülung links liegen ließ und hinunter hinters Haus tappte. Dort, an dem Platz, wo einmal neben dem Misthaufen der Abtritt gewesen war, hatte er frische Luft um die Nase, während er mit dem Urinstrahl auf den eisernen Rost am Boden zielte, unter dem er die Jauchegrube wusste. Je nachdem, wie der Mond sich dabei zeigte, konnte er dann am nächsten Tag Vorhersagen über das zu erwartende Wetter machen.
Ein langer Gang verband jetzt die Zimmer dieser Ebene mit der Treppe und die hohe Christusfigur, die in einer Nische auf der großen Kommode ihren Platz hatte und zu deren Füßen links und rechts zwei gegengleiche „Schlafende Johannes“ ausharrten, darbte seither im Finstern. Bis auf Fronleichnam. Dann wurde der Herr Jesus, der mit zwei Fingern seiner rechten Hand auf sein brennendes Herz deutete, welches er außen auf dem weißen Hemd trug, zusammen mit den Johannes-Zwillingen gewaschen und unten in der Nische vor dem Portal aufgebaut. Von dort aus konnten sie auf die Girlanden schauen, die von allen Familien des Dorfes am Vortag geknüpft worden waren und die Prozessionswege säumten. Oder, wenn es so weit war, die vorbeiziehende Prozession betrachten, zwischen dunkelroten Pfingstrosen hervor, die trotz aller Pracht bitter grün rochen, und Lupinen, die sich in ihrem samtig bitteren Duft immer nach der Form der Vase verbogen, in der sie steckten.
Das Kind, dem eine besondere Neigung zum Beobachten und ein heftiges Verlangen nach Verstehen eigen waren, nutzte diese Gelegenheit, des Herrn Jesu Antlitz zu studieren, wenn es ihm nun, einmal im Jahr, von Angesicht zu Angesicht begegnen konnte. Da fühlte es sich eigentümlich getröstet, dass unser Herr – trotz des nackten Herzens außen, so ungeschützt auf dem langen Hemd, und allem, was ihm sonst schon widerfahren war – so nachsichtig guckte, während die beiden Johannesse einfach alles verschliefen.
Langeweile war dem Kinde fremd. Immer gab es Ungereimtes zu reimen, planvoll Scheinendes nach wahrer Bedeutung zu durchsuchen, Fragmente aufzulesen, Lückenhaftes zu ergänzen und mit dem bisher Verstandenen sinnvoll zu verbinden. Zwei Onkel, eine Tante, Oma und Opa, Mutter und Vater waren schon für sich allein schwer verständlich. Erst recht im Zusammenleben unter diesem einen Dach gaben sie ausreichend Anlass zu Forschungen.
Bis auf den Vater und Trina schafften alle Mitglieder des Hauses gemeinsam auf den Feldern, in Garten und Stall und in den Weinbergen. Von Trina, der Oma des Kindes, die von ihm, wie von allen Übrigen im Hause, Mama genannt wurde, stammte die Auffassung, zu den besseren Leuten zu gehören. Vielleicht wurde deshalb allein ihr niemals richtige Arbeit zugemutet. Sie wurde wie eine Prinzessin gehalten, stand, durch wohlgeplättete Trägerschürzen vor Schmutz und schlechtem Ansehen geschützt, ihrem Hausstand vor und führte ein bisschen Regie in der Küche. Ihr war es vorbehalten, aus dem köstlichen Rahm, der die Woche über gesammelt wurde, eigenhändig die Butter zu bereiten. Natürlich war die Qualität dieser Butter der anderer Bauern weit überlegen. Der Buttertag war auch der Tag, an dem Trina nach dem Buttern aus einer Schublade im Küchenschrank den Packen Tageszeitungen der vergangenen Woche hervorzog. Den legte sie vor sich hin auf den Küchentisch, setzte sich dazu und begann damit, ihn mithilfe des großen Bratenwenders zu zerteilen. Erst wurden die Zeitungen, die ja bereits zur Hälfte zusammengefaltet übereinanderlagen, mit der Metallklinge dem Kniff entlang zertrennt. Dann wurden die Zeitungshälften erneut gefaltet und die Spalterei schritt fort, bis alle Blätter einen netten Papierstapel in handlicher Größe bildeten. Mit diesem wurde dann der Emaillebehälter mit der Aufschrift „Zwiebeln“ in der Toilette aufgefüllt. Danach setzte Trina einen frisch gefüllten Wasserkessel auf den Kohleherd und sich selbst auf einen Stuhl daneben, die Kaffeemühle zwischen die Knie geklemmt. Vielversprechend quietschte die Kurbel und der Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen zog durch die Küche. Bald klopfte es an der Tür, denn es war Mittwoch. Buttern, Klopapier zurechtmachen und der Besuch von Trinas Schwester Lena aus dem Nachbarhaus bedeuteten, dass die Hälfte der Arbeitswoche erreicht war.
Die Küche ist der Lebensraum des Hauses. Das wissen auch alle Fliegen. Sogar den Winter überlebten einige dort. Hoch oben an der Zimmerdecke hatten sie es dann weder mit dem Putzen der Flügel noch den ihnen sonst eigenen Geschäften besonders eilig. Im Sommer bevölkerte eine große Fliegenbande die Küchendecke und war dort wichtig unterwegs. Geschäftig eilten sie hier und da hin, stürzten sich in die Luft darunter und landeten durch die Kraft eines kleinen Purzelbaums wieder mit den Füßen an der Decke. Das Kind sah ihnen gerne zu und versuchte oft, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn es selbst dort oben an der Küchendecke herumspazieren könnte. Es dachte öfter darüber nach, ob die Fliegen eigentlich wussten, wo oben und unten ist. In jedem Sommer gab es einen Tag, an dem zu viele Fliegen in der Milch schwammen, die auf dem Kohleherd in einem großen Topf erhitzt werden musste, damit sie länger süß blieb. An diesem Tag besuchte Trina ihre Schwester, die nebenan wohnte und einen kleinen Laden hatte, wo die wichtigsten Dinge eines ländlichen Haushalts erworben werden konnten. Dort tranken die Schwestern in der Küche einen Kaffee. Die schmalen, dunklen Holzdielen dort wurden samstags immer mit Magermilch aufgewischt. Ein spezieller, säuerlicher Geruch hielt sich die ganze Woche über bis zur nächsten Anwendung. Trina kam dann mit drei Fliegenfängern zurück. Mit einem schmatzenden Geräusch entwickelten sich honigfarbene, glänzende Schillerlocken, wenn man die Fliegenfalle an einem roten Bändchen aus der kleinen Hülse zog. Sie rochen süßlich mit einem tückischen, ein wenig bitteren Duft im Hintergrund.