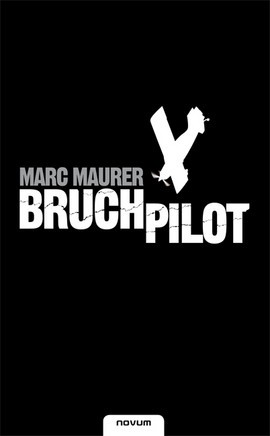Weltschmerz und Wahnsinn
Magdalena Ungersbäck
EUR 16,90
EUR 10,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 176
ISBN: 978-3-99107-768-8
Erscheinungsdatum: 15.12.2021
Amira aus Österreich, Antonio aus Italien, Ling aus China und der US-Amerikaner Jack: Was verbindet diese vier Personen? Es ist das Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt und das Coronavirus, das sich Anfang 2020 rasant auf der Erde ausbreitet.
Amira
17 Jahre, Bad Ischl, Österreich
9. November 2019
Sie sagen alle, mit siebzehn Jahren, da hat man noch Kraft und Energie, mit siebzehn Jahren, da ist man glücklich, hat Träume und Hoffnungen. Das ist die beste Zeit im Leben, sagen sie. Doch wie es wirklich ist, das Siebzehn-Sein in diesen Tagen, das wissen nur die Siebzehnjährigen ganz allein. Ich bin eine von ihnen und „die beste Zeit im Leben“ stelle ich mir wahrlich anders vor. Ich sitze regungslos da und das Flimmern des Fernsehers scheint die einzige Lichtquelle an diesem tristen Tag, der in schweren Nebel gehüllt ist. Der Reihe nach führe ich mir Dokumentationen und Shows zu Gemüte, die heute das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls feiern. Wie glücklich die Deutschen wirken, voller Lebensmut und Feierlaune, und ich freue mich mit ihnen, auch wenn es mir egal sein könnte. Doch dann fällt mir wieder ein, dass ich überhaupt keine Zeit zum Freuen habe. Mein Inneres krampft sich nervös zusammen. Denn es ist ja November, der Monat, in dem jeder Lehrer das dringende Bedürfnis verspürt, uns mit zigtausend Schularbeiten, Tests und Referaten überschütten zu müssen. Bildung ist schließlich wichtig. Bildung ist alles. Ohne Bildung bist du nichts. Du musst doch wissen, dass Triosephosphatisomerase als katalytisch perfektes Enzym gilt und wie man die Elektronegativität einer Atombindung bestimmt, denn das wird dir auch im Leben weiterhelfen. Bestimmt. Übermorgen, nach dem Test, werde ich nicht mehr darüber nachdenken, spätestens in einem Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern, jemals davon gehört zu haben und in fünf Jahren kann ich diese Wörter nicht einmal mehr aussprechen. Nicht einmal nach hundert Versuchen. Aber hört, hört! Bildung, Bildung! Man kann doch nie genug gebildet sein! Jedoch Wissen allein zählt auch nicht viel. Gegen Wissen ist nichts einzuwenden, ich weiß gerne viel. Doch dieses schöne Wissen muss tagtäglich bewiesen werden, sonst nützt es nicht viel. Leistungen bringen, das ist wichtig. Ständig und bedingungslos abliefern, das erwartet man von dir. Auch wenn du bis dahin wie ein Genie behandelt wirst: Sobald du auch nur in einem einzigen Unterrichtsfach versagst, wird dir nur dieser eine Misserfolg vor Augen gehalten, wird dir dein Versagen auf einem Silbertablett serviert. Stellt euch vor, ich kann auch einmal etwas nicht! Schande, unerträgliche Schande! Alles zielt auf ein Ereignis ab, die ganze Schikane bereitet uns mit gutem Willen auf die Matura vor. Die Matura, allein die Aussprache dieses Wortes muss dich in tiefe Ehrfurcht sinken lassen. Schon als ich vierzehn war, haben uns die Lehrer in reinste Panik versetzt mit diesem Wort. Jede einzelne Stunde fiel es mit donnernder Wucht über uns nieder, denn sie wollten uns Angst machen, damit wir alles geben, von Anfang bis zum Schluss. Damit am Ende nicht sie als Versager dastehen, damit sie ihre eigene Leistung vollbringen. Ohne Matura kommt man nicht weit, ohne Matura wird man nie etwas Großartiges, Weltbewegendes erreichen, hört man indirekt und doch so deutlich. Alles, was sie aus ihren Mündern speien, sind „Leistung“ und „Druck“. Wo soll das hinführen? Was erwartet man sich davon? Millionen gut gebildete Menschen, die auf Hochleistung laufen, um dem Versagen zu entkommen. Menschen, die nur nach Anerkennung lechzen und sich zu Tode schinden, um den Erfolg zu ergreifen. Schwäche ist schändlich, emotionale Intelligenz ist bloß ein Wort. Erfolgreich und todunglücklich, wenn alles gut geht – so stelle ich mir mein vorbestimmtes Leben vor. Und natürlich lässt sich leicht denken: „Übertreib doch nicht, so schlimm wird es schon nicht sein!“ Doch tagtäglich diese stoßende, penetrante Hand im Rücken zu spüren, die dich immer weiter nach vorne drückt, selbst wenn du eine Pause brauchst, um Luft zu holen, die mit Angst auf dich einprügelt, wenn du dich dem Wahn entziehst und dir die Pause einfach nimmst: Davon verstehen die, die das nicht ertragen müssen, nichts. Die Leiden eines jungen Menschen werden mit einer kleinen Handbewegung und einem verständnislosen Schnauben weggefegt.
„Stell dich nicht so an, Amira! Steigere dich nicht so hinein!“
„Du bist so ernst, schau doch nicht immer so indigniert!“
„Was ist los mit dir? Du bist zu nichts zu gebrauchen!“
„Du bist so langweilig! Du bist doch noch jung, wie soll das noch mit dir weitergehen!“
„In deinem Alter wollte ich was erleben!“
Danke, vielen Dank. Ich will doch selbst gern etwas erleben, einfach Mensch sein. Tollpatschig und voller Fehler. Aber die Bildung, diese unersetzliche Bildung, von der ich noch nicht genug habe, zwingt mich jahrelang in einem dunklen Raum zu sitzen, nur mit Büchern, Heften und einem Laptop. Und ich lasse mich zwingen, ich bin eine dieser Unglücklichen, die sich dazu zwingen lässt, damit ich die Leistung erbringe, die man von mir erwartet. Die dunkle Hand im Rücken stößt mich weiter und weiter und ich gebe ihr nach. Ist es da verwunderlich, dass ich so lustlos schaue, dass ich kraftlos und langweilig bin? Ich stehe auf, beende das Flimmern des Fernsehers und somit auch das letzte freudige Licht im Haus. Schließlich habe ich keine Zeit, mich der Freude hinzugeben, schließlich spüre ich wieder den festen Handabdruck in meinem Rücken. So schleiche ich in mein Zimmer, wohin mich die Hand schiebt, wo die heulenden Bücher und Hefte liegen. Auf dem Weg bleibe ich kurz vor dem großen, langen Spiegel stehen, der den Gang schmückt und starre mich an, erkenne mich gar nicht wieder. Meine schwarzen Haare werden stumpf, die grünblauen Augen verlieren das aufgeregte Leuchten und die eigentlich so braune Haut wird unnatürlich blass. Doch ich werde mich nicht laut darüber beschweren. Ich schreie. Ich schreie leise. In meinem Inneren. Denn ich weiß, sobald ich meinen Schmerz laut in Worte fassen würde, wäre Verständnis das Letzte, das mich erreichen würde. Wütende, genervte Blicke träfen mich. „Du musst doch nicht in die Schule, dann geh doch arbeiten!“, höre ich sie schon fauchen. Wenn es doch so einfach wäre! Ist es nicht egal, wohin ich gehe, ob Schule oder Arbeit? Die dunkle, drückende Hand im Rücken wird mich überallhin verfolgen. Durch die gesamte Welt. Weil ich mich verfolgen lasse, weil ich mich nicht dagegen wehren kann, sie nicht einfach wegschlage. Es ist meine Schuld.
Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich bin das Wrack meiner Seele. Obwohl ich doch erst siebzehn Jahre alt bin.
Antonio
32 Jahre, Bergamo, Italien
11. November 2019
Ich schlurfe durch die graue Stadt und merke, wie vertraut Bergamo mir ist. Ich hatte es schon fast vergessen, zu lang bin ich nicht mehr hier gewesen. Und trotz des vertrauten Gefühls von Heimat und von Ruhe füllt sich die Leere in meinem Inneren nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass die stille Verzweiflung, die tagtäglich meine Kehle zuschnürt, verschwinden würde, wenn ich einmal hier bin. Vergebens. Es ist wohl sinnlos. Ich gehe weiter, betrachte hin und wieder meinen dicken Schal und meine dunkelblaue Jacke in den Fensterscheiben der funkelnden Geschäfte, an denen ich vorbeigehe. Blicke auf mein eingefallenes Gesicht und auf die tiefen Ringe unter den Augen vermeide ich dagegen. Ich hasse Herbst und Winter. Ich hasse diese grauenhafte Kälte, die sich bis in meine Knochen frisst. Immer ist es grau und nebelig – meine Stimmung verschmilzt mit dem Wetter. Ich kann nicht ausgeglichen oder gar glücklich sein bei dieser endlosen Nässe. Was bin ich bloß für ein Sensibelchen? Ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern und zu meinem Bruder, zu dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich sollte mich doch freuen, gleich von meiner Mutter aus Überschwang fast zerquetscht zu werden, den vertrauten Handschlag meines Bruders Giorgio zu spüren und das wohlwollende Lächeln meines Vaters zu erhalten. Doch all das fühlt sich so endlos weit weg an. Ich fühle mich von allem und jedem schrecklich entfernt. Als wäre ich immer abwesend und befände mich in meiner eigenen Welt aus bedrückenden Gedanken. Sobald ich unser Haus betreten werde, wird mich meine Mutter mit Fragen bombardieren. Sie wird fragen, wie es mir in Rom gefällt, wo genau meine Wohnung liegt und wie vielen Menschen ich schon wieder das Leben gerettet habe, seitdem ich Arzt im Hospital of the Holy Spirit geworden bin. Ich werde wohlwollend lächeln und sagen, dass es wunderschön in Rom sei, dass meine Wohnung eine Traumwohnung sei und mein Beruf mich erfülle. Das ist ja wohl auch die Wahrheit. Es scheint doch alles perfekt zu sein. Doch warum fühle ich mich so leer und verloren? Vielleicht weil ich das Leid der Menschen nicht vergessen kann und weil dieses Leid niemand lindern kann. Als Arzt will ich Menschen helfen und die meisten Menschen, die zu mir kommen, gehen wieder gesund von mir weg. Darauf bin ich stolz. Aber da gibt es auch unheilbare Krankheiten, Unfälle und Tod. Monatlich, wöchentlich, täglich. Und natürlich kann ich das ertragen, lasse es nicht zu nah an mich heran, sonst wäre ich wohl nicht fähig, Arzt zu sein. Das ist ein Kinderspiel geworden. Trotzdem begreife ich die Ungerechtigkeit der Welt nicht, verstehe ich nicht, warum das Menschsein weh tun muss. Plötzlich bemerke ich, wie meine Schritte immer schneller werden und wie sich die Kälte des Windes durch meinen Körper frisst. Immer wenn ich in Gedanken bin, fange ich unbewusst zu rennen an. Ich laufe und laufe, laufe vielleicht vor meinen eigenen Gedanken davon. So schnell wie jetzt bin ich diesen Weg noch nie gegangen. Ich sehe schon das Haus meiner Familie, schlucke schwer angesichts der Erwartung, dass mich meine Mutter nicht nur auf mein jetziges Leben in Rom ansprechen wird, sondern auch auf die Zeit davor und wie froh sie ist, dass diese Zeit vorbei ist. Es wird immer wieder angesprochen, immer und immer wieder. Denn am Höhepunkt der Flüchtlingskrise fühlte ich mich gebraucht, fühlte ich mich verpflichtet, nicht nur auf der Seite zu stehen und zu glotzen. Ich fuhr die letzten Jahre nur von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager und versuchte den Schmerz der Geflohenen ein bisschen zu lindern. Auch sie brauchten Ärzte, wenn sie krank waren, und krank waren sie oft. Gebrochene Menschen werden leichter krank. Mit meiner Familie darüber reden: Das will ich aber nicht, kann ich einfach nicht. Ich will nicht ständig daran erinnert werden, an diese Bilder, die niemals verschwinden werden. Natürlich bereue ich keinen einzigen Tag, den ich den geflüchteten Menschen gewidmet habe, aber mir scheint, dass ihr ganzer Schmerz sich auf mich übertragen hat. Die Angst vor einer unsicheren Zukunft, die Angst vor dem bereits Erlebten: Man konnte sie förmlich spüren, jedes Mal, wenn man ihre dünnen Beine und knochigen Arme berührte. Als sie alle in diesen Zelten zusammengepfercht kauerten und ich mich durch sie hindurchschlängelte, von einem Kranken zum anderen, lag pure Verzweiflung in der Luft. Wie ungewollt und ungeliebt sie sich fühlen mussten, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Es tat so furchtbar weh. Irgendwann hatte ich genug von Flüchtlingslagern und ertrug diese überfüllten, verschmutzten und überschwemmten Zelte und Container nicht mehr, doch das Verlangen, zu helfen und etwas zu ändern, blieb. So fuhr ich von Hafen zu Hafen. Dort durften NGO-Rettungsschiffe nicht mehr anlegen, denn diejenigen mit der Macht in der Hand, diese „Menschenfreunde“, hatten es verboten. Sollen die Ausländer doch auf diesen Booten verrecken! Hätten sie es doch nicht gewagt, sich nach Europa zu begeben. Wir brauchen keine Flüchtlinge. Es ist ihre eigene Schuld.
Wie grausam Menschen sein können. Würden unsere werten Menschenfreunde immer noch so reden, wenn sie selbst einmal auf diesen Booten stünden? Wenn sie das sähen, was ich gesehen hatte? Was hatte ich denn gesehen? Als ich so an den Häfen stand und auf die Ruhe und Weite des Meeres blickte, verloren dort draußen Menschen ihren Verstand. Sie badeten in Angst auf den Schiffen, die nicht anlegen durften. Die See war ruhig, die Wellen waren leicht und das Plätschern zart. Auf den ersten Blick sah man nichts als ein friedliches Schiff. Doch dieser Friede war Illusion und bloßer Trug, das Schiff wurde von reinster Panik überflutet, die man vom Ufer nicht sah, nicht einmal spürte. Die heile Welt schien echt. Doch die, die noch nicht selbst ertrunken waren, ertränkten dort ihre letzte Hoffnung. Platzangst, Seekrankheit, Ungewissheit. So brachte man mich auf diese Schiffe. Ich sah, wie die Flüchtlinge durchdrehten und sich gegenseitig zu hassen begannen, weil sie schon zu lange auf zu engem Platz aufeinander klebten. Es war heiß und eng. Ich schwitzte wohl mehr Schweiß, als Wasser im Meer war, und ihre Seelen schienen dahinzusiechen. Sie drehten durch und erschlugen sich fast. Sie sprangen von der Reling und wollten ans Ufer schwimmen. Sie wollten endlich ihren Frieden, der nirgends in Sicht war, finden. Ich half dabei, die Ausreißer aus dem Meer zu fischen und zurück auf das Boot zu holen, verband Wunden und spritzte hie und da ein Beruhigungsmittel, wenn man mich darum bat, wenn die leeren Augen mich wirr und fast irr ansahen. Doch das, was mich bis heute verfolgt, was mich nicht mehr loslässt, was ich niemals vergessen werde, sind die großen, dunklen Kinderaugen, die mich voller Angst und Traurigkeit und doch gnadenlos anstarrten, die sich unter Tränen winselnd windeten und sich in den dunklen, muffigen Ecken der Schiffe nach einer sicheren Heimat sehnten. Kinder, denen dieses große „Warum“ auf der Zunge brannte. Die den Wahnsinn um jede Ecke lugen sahen. Auch wenn die Flüchtlingskrise noch nicht zu Ende ist und wohl auch so bald kein Ende nehmen wird, habe ich vor kurzem mit trauriger Erkenntnis eingesehen, dass ich nicht mehr helfen kann. Ich habe getan, was ich konnte. Mehrere Jahre lang. Es ist genug, für mich ist es vorbei. Nur wenige verstehen, warum ich mir das überhaupt angetan habe. Mein Vater sagte damals, ich sei ein „Gutmensch“, meine Mutter war stolz. Ich will einfach vergessen. Deshalb wohne ich nun in Rom, in einer bezaubernden Wohnung und arbeite als Arzt in einem hervorragenden Krankenhaus – in der Hoffnung, keinem zu begegnen, der mich darauf ansprechen kann, der den Menschen kennt, der ich einst war. Damit ich in mich hineinschweigen kann. Plötzlich stehe ich vor unserem Haus; ich habe gar nicht realisiert, wie schnell und gedankenverloren ich durch Bergamo gegangen bin. Ich atme aus, puste mühevoll die Gedanken davon und schließe die Haustür auf. Dieser vertraute Geruch und diese vertrauten Stimmen kommen mir entgegen und bringen mich unverhofft zum Lächeln, auch wenn es ein müdes Lächeln ist.
Ling
44 Jahre, Peking, China
20. November 2019
Mein Handy hat vibriert und ich habe es ignoriert. Obwohl es auf dem Tisch liegt, direkt neben mir. Obwohl ich gesehen habe, dass es Xiaolong war, mein Mann. Ich sitze, wie fast jeden Tag, hier im Büro als Sekretärin einer Modefirma. Der Raum ist riesig, fast eine Halle, und nebeneinander stehen gefühlt Tausende Schreibtische mit Tausenden Computern. Und unter diesen Tausenden Menschen, die hier arbeiten, sitze ich unbemerkt da, starre auf meine Tastatur und ignoriere meinen Mann. Ich weiß doch, was er mir sagen will. Ich könne ruhig Überstunden machen, ich solle mich brav von allen verabschieden, wenn ich nach Hause gehe, ich müsse aufmerksam die Straßenverkehrsregeln beachten, wenn ich zur U-Bahn eile und dürfe dort auch keine Auffälligkeiten von mir geben. Er bläut mir dies schon seit Ewigkeiten ein und natürlich habe ich es immer fügsam befolgt. Nur die Überstunden nicht. Auf die verzichte ich. Wie auch heute. Ich will nach Hause. Zu meinem Kind, zu meinem Bett und auch ein bisschen zu meinem Mann. Ein bisschen. Ich schalte den Computer aus, erhasche mein angespanntes Gesicht auf dem schwarzen Bildschirm, stehe auf, sage brav zu allen „bis morgen“ und mache mich auf den Weg nach Hause. Es ist schon fast dunkel und ich will mich beeilen, aber nicht zu sehr, denn dann wäre ich auffällig und unaufmerksam und würde vielleicht einen Fehler machen. Bei Rot über die Straße laufen oder jemanden anrempeln. Das wäre fatal. Vorsichtig hebe ich den Blick. An jeder Straßenecke sind Kameras, die sofort wissen, wer ich bin, sobald sie mich eingefangen haben. Eigentlich leben wir in einer totalüberwachten Welt. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, ich habe nichts dagegen. Es ist sogar gut, es verspricht Sicherheit. Sicherheit für uns alle, wenn sie sehen, was wir tun. Sicherheit sollte man vor Freiheit stellen, nicht wahr? Das ist vernünftig und vernünftig sollten wir sein. Dann können Kriminelle sofort identifiziert und verhaftet werden. Gut, ich bin dafür. Ich eile durch Peking, das am Abend immer schriller und bunter wird, Tausende Geräusche und blinkende Lichter prasseln auf mich herab. Zügig husche ich durch die U-Bahn-Stationen und die Wohngassen, bis ich unsere Wohnung erreiche. Die schwere Eingangstür des Gebäudes aufgemacht – die Stiegen hinauf, die bis in die Unendlichkeit zu führen scheinen – den Schlüssel in die Wohnungstür – drehen – Knack – und offen. Ich trete ein und sehe Xiaolong am Küchentisch sitzen, den Kopf über eine Zeitung gebeugt.
„Hallo, da bin ich!“
„Hallo Ling, sieh da!“ Er winkt mich gleich zu sich und trommelt auf die Zeitung: „Das scheint die perfekte Wohnung zu sein!“
Ich beuge mich zu ihm, betrachte das Bild und den Preis und sage: „Ja, perfekt.“
Wir wollen nach Shanghai ziehen, brauchen dort eine schöne Wohnung. Eine schönere als jetzt. Und eine größere. Xiaolong hat nämlich ein Jobangebot dort erhalten. Er will es annehmen, denn dann ist er bedeutender als jetzt. Kein gewöhnlicher Polizist mehr, nein, ein richtig einflussreicher Polizist, so sagt er.
Er schlägt die Zeitung zu und mustert mich.
„Du hast nicht abgehoben.“
„Ich wusste doch, was du mir sagen willst.“
„Gut.“ Er stockt, dann holt er nochmals aus: „Ling, es ist wirklich wichtig. Wir müssen uns benehmen!“
„Tun wir doch.“
„Ja. Wir brauchen nämlich die Punkte, wenn wir die Wohnung bekommen wollen und du einen neuen Job in Shanghai willst!“
„Ich weiß. Das ist jetzt keine Neuigkeit mehr!“ Ich bin genervt von seiner ständigen Leier wegen der Punkte.
Seit einigen Jahren gibt es eine Testphase in einigen chinesischen Städten für das Sozial-Kredit-System. Danach bekommt man Plus- oder Minuspunkte für sein Verhalten. Wenn du zum Beispiel auf die Straße spuckst oder bei Rot über die Straße läufst, bekommst du Minuspunkte. Wenn du regelmäßig deine Eltern anrufst oder jemandem hilfst, Sachen, die ihm zu Boden gefallen sind, aufzuheben, dann bekommst du Pluspunkte. Das soziale Verhalten zählt. Die Kameras nehmen alles auf. Sobald du zu viele Minuspunkte auf deinem Konto hast, kommst du auf die Schwarze Liste und dann ist dein Leben eigentlich gelaufen. Du wirst kein Zug- oder Flugticket mehr erhalten, keine Wohnung und keinen Job finden oder deine jetzigen Besitztümer sogar verlieren. Wie surreal das klingt! Ab 2020 soll dieses Punktesystem in ganz China gelten. Xiaolong und ich wollen natürlich jetzt schon viele Punkte machen, damit wir bald in Shanghai ein schönes Leben beginnen können. Ein schönes Leben. Er soll trotzdem mit dem Geschwafel von den Punkten aufhören. Das Kind ist wohl wichtiger.
„Wie geht es Maja?“, frage ich ihn, „wart ihr im Krankenhaus?“
„Ja. Sie schläft jetzt. Sie hat die Infusionen bekommen und auch neue Medikamente“, antwortet mein Mann, ohne den Blick von der geschlossenen Zeitung zu nehmen.
„Hat sie wieder erbrochen?“
„Ja, aber nur ein einziges Mal!“
„Gut. Ich gehe zu ihr!“
Ich drehe mich um und gehe in Majas Zimmer. In das Zimmer meiner zwölfjährigen Tochter. Vorsichtig öffne ich die Türe und schleiche mich an ihr Bett. Es ist stockdunkel, die Vorhänge sind zugezogen und es riecht nach Schlaf. Ich sehe rein gar nichts, muss mich langsam und unbeholfen vorantasten. Nur ihr sanftes Atmen ist zu hören. Sachte lasse ich mich auf ihrem Bett, neben ihr, nieder und streichle ihr zartes, warmes Gesicht. Sie hat das alles nicht verdient. Sie ist zu lieb für diese Welt, für dieses Schicksal. Mein armes Kind. Der Vater redet nur von Punkten, die Mutter ständig im Büro, das Kind verseucht von Leukämie.
17 Jahre, Bad Ischl, Österreich
9. November 2019
Sie sagen alle, mit siebzehn Jahren, da hat man noch Kraft und Energie, mit siebzehn Jahren, da ist man glücklich, hat Träume und Hoffnungen. Das ist die beste Zeit im Leben, sagen sie. Doch wie es wirklich ist, das Siebzehn-Sein in diesen Tagen, das wissen nur die Siebzehnjährigen ganz allein. Ich bin eine von ihnen und „die beste Zeit im Leben“ stelle ich mir wahrlich anders vor. Ich sitze regungslos da und das Flimmern des Fernsehers scheint die einzige Lichtquelle an diesem tristen Tag, der in schweren Nebel gehüllt ist. Der Reihe nach führe ich mir Dokumentationen und Shows zu Gemüte, die heute das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls feiern. Wie glücklich die Deutschen wirken, voller Lebensmut und Feierlaune, und ich freue mich mit ihnen, auch wenn es mir egal sein könnte. Doch dann fällt mir wieder ein, dass ich überhaupt keine Zeit zum Freuen habe. Mein Inneres krampft sich nervös zusammen. Denn es ist ja November, der Monat, in dem jeder Lehrer das dringende Bedürfnis verspürt, uns mit zigtausend Schularbeiten, Tests und Referaten überschütten zu müssen. Bildung ist schließlich wichtig. Bildung ist alles. Ohne Bildung bist du nichts. Du musst doch wissen, dass Triosephosphatisomerase als katalytisch perfektes Enzym gilt und wie man die Elektronegativität einer Atombindung bestimmt, denn das wird dir auch im Leben weiterhelfen. Bestimmt. Übermorgen, nach dem Test, werde ich nicht mehr darüber nachdenken, spätestens in einem Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern, jemals davon gehört zu haben und in fünf Jahren kann ich diese Wörter nicht einmal mehr aussprechen. Nicht einmal nach hundert Versuchen. Aber hört, hört! Bildung, Bildung! Man kann doch nie genug gebildet sein! Jedoch Wissen allein zählt auch nicht viel. Gegen Wissen ist nichts einzuwenden, ich weiß gerne viel. Doch dieses schöne Wissen muss tagtäglich bewiesen werden, sonst nützt es nicht viel. Leistungen bringen, das ist wichtig. Ständig und bedingungslos abliefern, das erwartet man von dir. Auch wenn du bis dahin wie ein Genie behandelt wirst: Sobald du auch nur in einem einzigen Unterrichtsfach versagst, wird dir nur dieser eine Misserfolg vor Augen gehalten, wird dir dein Versagen auf einem Silbertablett serviert. Stellt euch vor, ich kann auch einmal etwas nicht! Schande, unerträgliche Schande! Alles zielt auf ein Ereignis ab, die ganze Schikane bereitet uns mit gutem Willen auf die Matura vor. Die Matura, allein die Aussprache dieses Wortes muss dich in tiefe Ehrfurcht sinken lassen. Schon als ich vierzehn war, haben uns die Lehrer in reinste Panik versetzt mit diesem Wort. Jede einzelne Stunde fiel es mit donnernder Wucht über uns nieder, denn sie wollten uns Angst machen, damit wir alles geben, von Anfang bis zum Schluss. Damit am Ende nicht sie als Versager dastehen, damit sie ihre eigene Leistung vollbringen. Ohne Matura kommt man nicht weit, ohne Matura wird man nie etwas Großartiges, Weltbewegendes erreichen, hört man indirekt und doch so deutlich. Alles, was sie aus ihren Mündern speien, sind „Leistung“ und „Druck“. Wo soll das hinführen? Was erwartet man sich davon? Millionen gut gebildete Menschen, die auf Hochleistung laufen, um dem Versagen zu entkommen. Menschen, die nur nach Anerkennung lechzen und sich zu Tode schinden, um den Erfolg zu ergreifen. Schwäche ist schändlich, emotionale Intelligenz ist bloß ein Wort. Erfolgreich und todunglücklich, wenn alles gut geht – so stelle ich mir mein vorbestimmtes Leben vor. Und natürlich lässt sich leicht denken: „Übertreib doch nicht, so schlimm wird es schon nicht sein!“ Doch tagtäglich diese stoßende, penetrante Hand im Rücken zu spüren, die dich immer weiter nach vorne drückt, selbst wenn du eine Pause brauchst, um Luft zu holen, die mit Angst auf dich einprügelt, wenn du dich dem Wahn entziehst und dir die Pause einfach nimmst: Davon verstehen die, die das nicht ertragen müssen, nichts. Die Leiden eines jungen Menschen werden mit einer kleinen Handbewegung und einem verständnislosen Schnauben weggefegt.
„Stell dich nicht so an, Amira! Steigere dich nicht so hinein!“
„Du bist so ernst, schau doch nicht immer so indigniert!“
„Was ist los mit dir? Du bist zu nichts zu gebrauchen!“
„Du bist so langweilig! Du bist doch noch jung, wie soll das noch mit dir weitergehen!“
„In deinem Alter wollte ich was erleben!“
Danke, vielen Dank. Ich will doch selbst gern etwas erleben, einfach Mensch sein. Tollpatschig und voller Fehler. Aber die Bildung, diese unersetzliche Bildung, von der ich noch nicht genug habe, zwingt mich jahrelang in einem dunklen Raum zu sitzen, nur mit Büchern, Heften und einem Laptop. Und ich lasse mich zwingen, ich bin eine dieser Unglücklichen, die sich dazu zwingen lässt, damit ich die Leistung erbringe, die man von mir erwartet. Die dunkle Hand im Rücken stößt mich weiter und weiter und ich gebe ihr nach. Ist es da verwunderlich, dass ich so lustlos schaue, dass ich kraftlos und langweilig bin? Ich stehe auf, beende das Flimmern des Fernsehers und somit auch das letzte freudige Licht im Haus. Schließlich habe ich keine Zeit, mich der Freude hinzugeben, schließlich spüre ich wieder den festen Handabdruck in meinem Rücken. So schleiche ich in mein Zimmer, wohin mich die Hand schiebt, wo die heulenden Bücher und Hefte liegen. Auf dem Weg bleibe ich kurz vor dem großen, langen Spiegel stehen, der den Gang schmückt und starre mich an, erkenne mich gar nicht wieder. Meine schwarzen Haare werden stumpf, die grünblauen Augen verlieren das aufgeregte Leuchten und die eigentlich so braune Haut wird unnatürlich blass. Doch ich werde mich nicht laut darüber beschweren. Ich schreie. Ich schreie leise. In meinem Inneren. Denn ich weiß, sobald ich meinen Schmerz laut in Worte fassen würde, wäre Verständnis das Letzte, das mich erreichen würde. Wütende, genervte Blicke träfen mich. „Du musst doch nicht in die Schule, dann geh doch arbeiten!“, höre ich sie schon fauchen. Wenn es doch so einfach wäre! Ist es nicht egal, wohin ich gehe, ob Schule oder Arbeit? Die dunkle, drückende Hand im Rücken wird mich überallhin verfolgen. Durch die gesamte Welt. Weil ich mich verfolgen lasse, weil ich mich nicht dagegen wehren kann, sie nicht einfach wegschlage. Es ist meine Schuld.
Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich bin das Wrack meiner Seele. Obwohl ich doch erst siebzehn Jahre alt bin.
Antonio
32 Jahre, Bergamo, Italien
11. November 2019
Ich schlurfe durch die graue Stadt und merke, wie vertraut Bergamo mir ist. Ich hatte es schon fast vergessen, zu lang bin ich nicht mehr hier gewesen. Und trotz des vertrauten Gefühls von Heimat und von Ruhe füllt sich die Leere in meinem Inneren nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass die stille Verzweiflung, die tagtäglich meine Kehle zuschnürt, verschwinden würde, wenn ich einmal hier bin. Vergebens. Es ist wohl sinnlos. Ich gehe weiter, betrachte hin und wieder meinen dicken Schal und meine dunkelblaue Jacke in den Fensterscheiben der funkelnden Geschäfte, an denen ich vorbeigehe. Blicke auf mein eingefallenes Gesicht und auf die tiefen Ringe unter den Augen vermeide ich dagegen. Ich hasse Herbst und Winter. Ich hasse diese grauenhafte Kälte, die sich bis in meine Knochen frisst. Immer ist es grau und nebelig – meine Stimmung verschmilzt mit dem Wetter. Ich kann nicht ausgeglichen oder gar glücklich sein bei dieser endlosen Nässe. Was bin ich bloß für ein Sensibelchen? Ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern und zu meinem Bruder, zu dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich sollte mich doch freuen, gleich von meiner Mutter aus Überschwang fast zerquetscht zu werden, den vertrauten Handschlag meines Bruders Giorgio zu spüren und das wohlwollende Lächeln meines Vaters zu erhalten. Doch all das fühlt sich so endlos weit weg an. Ich fühle mich von allem und jedem schrecklich entfernt. Als wäre ich immer abwesend und befände mich in meiner eigenen Welt aus bedrückenden Gedanken. Sobald ich unser Haus betreten werde, wird mich meine Mutter mit Fragen bombardieren. Sie wird fragen, wie es mir in Rom gefällt, wo genau meine Wohnung liegt und wie vielen Menschen ich schon wieder das Leben gerettet habe, seitdem ich Arzt im Hospital of the Holy Spirit geworden bin. Ich werde wohlwollend lächeln und sagen, dass es wunderschön in Rom sei, dass meine Wohnung eine Traumwohnung sei und mein Beruf mich erfülle. Das ist ja wohl auch die Wahrheit. Es scheint doch alles perfekt zu sein. Doch warum fühle ich mich so leer und verloren? Vielleicht weil ich das Leid der Menschen nicht vergessen kann und weil dieses Leid niemand lindern kann. Als Arzt will ich Menschen helfen und die meisten Menschen, die zu mir kommen, gehen wieder gesund von mir weg. Darauf bin ich stolz. Aber da gibt es auch unheilbare Krankheiten, Unfälle und Tod. Monatlich, wöchentlich, täglich. Und natürlich kann ich das ertragen, lasse es nicht zu nah an mich heran, sonst wäre ich wohl nicht fähig, Arzt zu sein. Das ist ein Kinderspiel geworden. Trotzdem begreife ich die Ungerechtigkeit der Welt nicht, verstehe ich nicht, warum das Menschsein weh tun muss. Plötzlich bemerke ich, wie meine Schritte immer schneller werden und wie sich die Kälte des Windes durch meinen Körper frisst. Immer wenn ich in Gedanken bin, fange ich unbewusst zu rennen an. Ich laufe und laufe, laufe vielleicht vor meinen eigenen Gedanken davon. So schnell wie jetzt bin ich diesen Weg noch nie gegangen. Ich sehe schon das Haus meiner Familie, schlucke schwer angesichts der Erwartung, dass mich meine Mutter nicht nur auf mein jetziges Leben in Rom ansprechen wird, sondern auch auf die Zeit davor und wie froh sie ist, dass diese Zeit vorbei ist. Es wird immer wieder angesprochen, immer und immer wieder. Denn am Höhepunkt der Flüchtlingskrise fühlte ich mich gebraucht, fühlte ich mich verpflichtet, nicht nur auf der Seite zu stehen und zu glotzen. Ich fuhr die letzten Jahre nur von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager und versuchte den Schmerz der Geflohenen ein bisschen zu lindern. Auch sie brauchten Ärzte, wenn sie krank waren, und krank waren sie oft. Gebrochene Menschen werden leichter krank. Mit meiner Familie darüber reden: Das will ich aber nicht, kann ich einfach nicht. Ich will nicht ständig daran erinnert werden, an diese Bilder, die niemals verschwinden werden. Natürlich bereue ich keinen einzigen Tag, den ich den geflüchteten Menschen gewidmet habe, aber mir scheint, dass ihr ganzer Schmerz sich auf mich übertragen hat. Die Angst vor einer unsicheren Zukunft, die Angst vor dem bereits Erlebten: Man konnte sie förmlich spüren, jedes Mal, wenn man ihre dünnen Beine und knochigen Arme berührte. Als sie alle in diesen Zelten zusammengepfercht kauerten und ich mich durch sie hindurchschlängelte, von einem Kranken zum anderen, lag pure Verzweiflung in der Luft. Wie ungewollt und ungeliebt sie sich fühlen mussten, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Es tat so furchtbar weh. Irgendwann hatte ich genug von Flüchtlingslagern und ertrug diese überfüllten, verschmutzten und überschwemmten Zelte und Container nicht mehr, doch das Verlangen, zu helfen und etwas zu ändern, blieb. So fuhr ich von Hafen zu Hafen. Dort durften NGO-Rettungsschiffe nicht mehr anlegen, denn diejenigen mit der Macht in der Hand, diese „Menschenfreunde“, hatten es verboten. Sollen die Ausländer doch auf diesen Booten verrecken! Hätten sie es doch nicht gewagt, sich nach Europa zu begeben. Wir brauchen keine Flüchtlinge. Es ist ihre eigene Schuld.
Wie grausam Menschen sein können. Würden unsere werten Menschenfreunde immer noch so reden, wenn sie selbst einmal auf diesen Booten stünden? Wenn sie das sähen, was ich gesehen hatte? Was hatte ich denn gesehen? Als ich so an den Häfen stand und auf die Ruhe und Weite des Meeres blickte, verloren dort draußen Menschen ihren Verstand. Sie badeten in Angst auf den Schiffen, die nicht anlegen durften. Die See war ruhig, die Wellen waren leicht und das Plätschern zart. Auf den ersten Blick sah man nichts als ein friedliches Schiff. Doch dieser Friede war Illusion und bloßer Trug, das Schiff wurde von reinster Panik überflutet, die man vom Ufer nicht sah, nicht einmal spürte. Die heile Welt schien echt. Doch die, die noch nicht selbst ertrunken waren, ertränkten dort ihre letzte Hoffnung. Platzangst, Seekrankheit, Ungewissheit. So brachte man mich auf diese Schiffe. Ich sah, wie die Flüchtlinge durchdrehten und sich gegenseitig zu hassen begannen, weil sie schon zu lange auf zu engem Platz aufeinander klebten. Es war heiß und eng. Ich schwitzte wohl mehr Schweiß, als Wasser im Meer war, und ihre Seelen schienen dahinzusiechen. Sie drehten durch und erschlugen sich fast. Sie sprangen von der Reling und wollten ans Ufer schwimmen. Sie wollten endlich ihren Frieden, der nirgends in Sicht war, finden. Ich half dabei, die Ausreißer aus dem Meer zu fischen und zurück auf das Boot zu holen, verband Wunden und spritzte hie und da ein Beruhigungsmittel, wenn man mich darum bat, wenn die leeren Augen mich wirr und fast irr ansahen. Doch das, was mich bis heute verfolgt, was mich nicht mehr loslässt, was ich niemals vergessen werde, sind die großen, dunklen Kinderaugen, die mich voller Angst und Traurigkeit und doch gnadenlos anstarrten, die sich unter Tränen winselnd windeten und sich in den dunklen, muffigen Ecken der Schiffe nach einer sicheren Heimat sehnten. Kinder, denen dieses große „Warum“ auf der Zunge brannte. Die den Wahnsinn um jede Ecke lugen sahen. Auch wenn die Flüchtlingskrise noch nicht zu Ende ist und wohl auch so bald kein Ende nehmen wird, habe ich vor kurzem mit trauriger Erkenntnis eingesehen, dass ich nicht mehr helfen kann. Ich habe getan, was ich konnte. Mehrere Jahre lang. Es ist genug, für mich ist es vorbei. Nur wenige verstehen, warum ich mir das überhaupt angetan habe. Mein Vater sagte damals, ich sei ein „Gutmensch“, meine Mutter war stolz. Ich will einfach vergessen. Deshalb wohne ich nun in Rom, in einer bezaubernden Wohnung und arbeite als Arzt in einem hervorragenden Krankenhaus – in der Hoffnung, keinem zu begegnen, der mich darauf ansprechen kann, der den Menschen kennt, der ich einst war. Damit ich in mich hineinschweigen kann. Plötzlich stehe ich vor unserem Haus; ich habe gar nicht realisiert, wie schnell und gedankenverloren ich durch Bergamo gegangen bin. Ich atme aus, puste mühevoll die Gedanken davon und schließe die Haustür auf. Dieser vertraute Geruch und diese vertrauten Stimmen kommen mir entgegen und bringen mich unverhofft zum Lächeln, auch wenn es ein müdes Lächeln ist.
Ling
44 Jahre, Peking, China
20. November 2019
Mein Handy hat vibriert und ich habe es ignoriert. Obwohl es auf dem Tisch liegt, direkt neben mir. Obwohl ich gesehen habe, dass es Xiaolong war, mein Mann. Ich sitze, wie fast jeden Tag, hier im Büro als Sekretärin einer Modefirma. Der Raum ist riesig, fast eine Halle, und nebeneinander stehen gefühlt Tausende Schreibtische mit Tausenden Computern. Und unter diesen Tausenden Menschen, die hier arbeiten, sitze ich unbemerkt da, starre auf meine Tastatur und ignoriere meinen Mann. Ich weiß doch, was er mir sagen will. Ich könne ruhig Überstunden machen, ich solle mich brav von allen verabschieden, wenn ich nach Hause gehe, ich müsse aufmerksam die Straßenverkehrsregeln beachten, wenn ich zur U-Bahn eile und dürfe dort auch keine Auffälligkeiten von mir geben. Er bläut mir dies schon seit Ewigkeiten ein und natürlich habe ich es immer fügsam befolgt. Nur die Überstunden nicht. Auf die verzichte ich. Wie auch heute. Ich will nach Hause. Zu meinem Kind, zu meinem Bett und auch ein bisschen zu meinem Mann. Ein bisschen. Ich schalte den Computer aus, erhasche mein angespanntes Gesicht auf dem schwarzen Bildschirm, stehe auf, sage brav zu allen „bis morgen“ und mache mich auf den Weg nach Hause. Es ist schon fast dunkel und ich will mich beeilen, aber nicht zu sehr, denn dann wäre ich auffällig und unaufmerksam und würde vielleicht einen Fehler machen. Bei Rot über die Straße laufen oder jemanden anrempeln. Das wäre fatal. Vorsichtig hebe ich den Blick. An jeder Straßenecke sind Kameras, die sofort wissen, wer ich bin, sobald sie mich eingefangen haben. Eigentlich leben wir in einer totalüberwachten Welt. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, ich habe nichts dagegen. Es ist sogar gut, es verspricht Sicherheit. Sicherheit für uns alle, wenn sie sehen, was wir tun. Sicherheit sollte man vor Freiheit stellen, nicht wahr? Das ist vernünftig und vernünftig sollten wir sein. Dann können Kriminelle sofort identifiziert und verhaftet werden. Gut, ich bin dafür. Ich eile durch Peking, das am Abend immer schriller und bunter wird, Tausende Geräusche und blinkende Lichter prasseln auf mich herab. Zügig husche ich durch die U-Bahn-Stationen und die Wohngassen, bis ich unsere Wohnung erreiche. Die schwere Eingangstür des Gebäudes aufgemacht – die Stiegen hinauf, die bis in die Unendlichkeit zu führen scheinen – den Schlüssel in die Wohnungstür – drehen – Knack – und offen. Ich trete ein und sehe Xiaolong am Küchentisch sitzen, den Kopf über eine Zeitung gebeugt.
„Hallo, da bin ich!“
„Hallo Ling, sieh da!“ Er winkt mich gleich zu sich und trommelt auf die Zeitung: „Das scheint die perfekte Wohnung zu sein!“
Ich beuge mich zu ihm, betrachte das Bild und den Preis und sage: „Ja, perfekt.“
Wir wollen nach Shanghai ziehen, brauchen dort eine schöne Wohnung. Eine schönere als jetzt. Und eine größere. Xiaolong hat nämlich ein Jobangebot dort erhalten. Er will es annehmen, denn dann ist er bedeutender als jetzt. Kein gewöhnlicher Polizist mehr, nein, ein richtig einflussreicher Polizist, so sagt er.
Er schlägt die Zeitung zu und mustert mich.
„Du hast nicht abgehoben.“
„Ich wusste doch, was du mir sagen willst.“
„Gut.“ Er stockt, dann holt er nochmals aus: „Ling, es ist wirklich wichtig. Wir müssen uns benehmen!“
„Tun wir doch.“
„Ja. Wir brauchen nämlich die Punkte, wenn wir die Wohnung bekommen wollen und du einen neuen Job in Shanghai willst!“
„Ich weiß. Das ist jetzt keine Neuigkeit mehr!“ Ich bin genervt von seiner ständigen Leier wegen der Punkte.
Seit einigen Jahren gibt es eine Testphase in einigen chinesischen Städten für das Sozial-Kredit-System. Danach bekommt man Plus- oder Minuspunkte für sein Verhalten. Wenn du zum Beispiel auf die Straße spuckst oder bei Rot über die Straße läufst, bekommst du Minuspunkte. Wenn du regelmäßig deine Eltern anrufst oder jemandem hilfst, Sachen, die ihm zu Boden gefallen sind, aufzuheben, dann bekommst du Pluspunkte. Das soziale Verhalten zählt. Die Kameras nehmen alles auf. Sobald du zu viele Minuspunkte auf deinem Konto hast, kommst du auf die Schwarze Liste und dann ist dein Leben eigentlich gelaufen. Du wirst kein Zug- oder Flugticket mehr erhalten, keine Wohnung und keinen Job finden oder deine jetzigen Besitztümer sogar verlieren. Wie surreal das klingt! Ab 2020 soll dieses Punktesystem in ganz China gelten. Xiaolong und ich wollen natürlich jetzt schon viele Punkte machen, damit wir bald in Shanghai ein schönes Leben beginnen können. Ein schönes Leben. Er soll trotzdem mit dem Geschwafel von den Punkten aufhören. Das Kind ist wohl wichtiger.
„Wie geht es Maja?“, frage ich ihn, „wart ihr im Krankenhaus?“
„Ja. Sie schläft jetzt. Sie hat die Infusionen bekommen und auch neue Medikamente“, antwortet mein Mann, ohne den Blick von der geschlossenen Zeitung zu nehmen.
„Hat sie wieder erbrochen?“
„Ja, aber nur ein einziges Mal!“
„Gut. Ich gehe zu ihr!“
Ich drehe mich um und gehe in Majas Zimmer. In das Zimmer meiner zwölfjährigen Tochter. Vorsichtig öffne ich die Türe und schleiche mich an ihr Bett. Es ist stockdunkel, die Vorhänge sind zugezogen und es riecht nach Schlaf. Ich sehe rein gar nichts, muss mich langsam und unbeholfen vorantasten. Nur ihr sanftes Atmen ist zu hören. Sachte lasse ich mich auf ihrem Bett, neben ihr, nieder und streichle ihr zartes, warmes Gesicht. Sie hat das alles nicht verdient. Sie ist zu lieb für diese Welt, für dieses Schicksal. Mein armes Kind. Der Vater redet nur von Punkten, die Mutter ständig im Büro, das Kind verseucht von Leukämie.