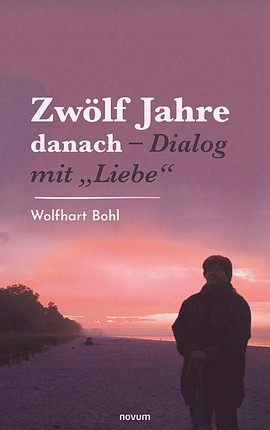Seeberger Kindertage
Georg Satirev
EUR 25,90
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 256
ISBN: 978-3-99146-721-2
Erscheinungsdatum: 23.04.2024
Literatur pur und ein respektabler Gegenentwurf zum digitalen „Laut, bunt – klick!“: Der Entfaltung von Gedanken im Gespräch zu folgen, wer nimmt sich für diesen Zauber noch die Zeit? In einer schwierigen Lebensphase wagen zwei gute Freunde genau das.
I
„Lerne im Leben die Kunst,
im Kunstwerk lerne das Leben.“
Friedrich Hölderlin
1
Wie beginnen?
Sollten wir unsere Erzählung über, sagen wir Paul Poth, wir könnten ihn aber auch, da Namen in Romanen oft ablenken oder zu falschen Assoziationen verleiten, abkürzen: P. P. – was doch mehr ist als das Niemand Homers – oder wohlklingend, aber etwas altertümlich und gekünstelt, Adrian oder, gut Deutsch, Ulrich oder Waldemar – das bayerische Woldemar – Starnberg, da unsere Geschichte auch an dem gleichnamigen See spielt, oder aristokratisch bayerisch Leopold oder francophon Frederic oder gar jüdisch, Gott hat gegeben, Nathan benennen, unseren Helden, der doch ein ziemlich gelungenes und erfreuliches, wenn auch nicht immer geradliniges, von manchen Brüchen, wie einer Ehescheidung, bestimmtes, aber ansonsten ein Leben führte, verschont von größeren Katastrophen – bis auf die eine, die Anlass dieses Berichtes wurde, die Diagnose einer im Regelfall tödlich verlaufenden Krankheit im Alter von Ende fünfzig kann man heutzutage schon als solche für den Betroffenen bezeichnen, ein Leben, welches dem gesellschaftlichen und politischen Umfeld, das sich friedvoll und geduldig entwickelte, entsprach, damit beginnen, uns selbst vorzustellen? Wohl wissend, dass das Erzählte durch die Sichtweise des Erzählenden, durch dessen Aus- und Wortwahl eben auch von diesem handelt, dass das Wissen, das Wer und Was des Schreibenden das Geschriebene verständlicher werden lässt, jedenfalls relativiert.
Wenn wir das täten, so wäre zu berichten, dass Paul Poth, für diesen Namen haben wir uns nun offensichtlich entschieden, dem Verfasser schon als Kind bekannt war, und dass der Erzähler die Ehre hat, sich bis zum heutigen Tag zu dessen Freunden zählen zu dürfen. Gemeinsam verbrachte Zeiten in der Kindheit, Jugend und als Studenten, gemeinsames
Auslandsstudium, wechselseitige Trauzeugen- und Patenschaften haben diese Freundschaft bestätigt und erlauben es, die folgenden Zeilen zu verantworten.
2
Sollten wir so beginnen: Von Süden wehte ein warmer, trockener Wind – der Föhn, den die Römer wohlklingend favonius nannten. Der Himmel war klar und die geringe Luftfeuchtigkeit des Föhns offenbarte einen herrlichen Blick vom parkähnlichen Garten des Herrn Konsul Dr. Poth auf die Alpenkette, aus der die Zugspitze herausragte. Es war ein schöner Julitag des Jahres 1959.
Der Starnberger See war, auch sonntags, noch nicht bedeckt von einem Meer weißer Segel, das Gefühl von Wind, Wasser und Bewegung auf ständige Ausweichmanöver reduzierend. Der See war ein hellblauer Farbfleck in weitem grünen Rund, mit einzelnen weißen Tupfern. Von dem Dorf Seeberg gab der Blick aus dem Wohnzimmer der Villa Poths in erster Linie die neubarocken Kirchtürme frei. Anders als vielleicht manche Städte war Seeberg nicht an dessen Gang zu erkennen, da zu dieser Mittagszeit so gut wie nichts in Bewegung war.
Der Möbelfabrikant und Kunsthändler Poth hatte, seiner Gewohnheit folgend, den Sonntagmorgen mit einem Bad im Starnberger See begonnen. Er benutzte dazu seine Badehütte, die vom Ufer aus in den See gebaut war und ihm einen exklusiven Seezugang ermöglichte. Er tauchte in die glatte Wasserfläche. Das Wasser war angenehm, um die dreiundzwanzig Grad und dennoch am Morgen erfrischend. Sein Blick war frei auf das andere Seeufer, noch nicht wie heutzutage durch zahlreiche Bojen und daran hängende abgetakelte Segelboote verstellt. Die gegenüberliegenden Türme des Ammerlander Schlosses, das einst dem Grafen Pocci gehörte, waren gegen die tiefstehende, aber schon warme Sonne nur schemenhaft wahrzunehmen. In der südlichen Ferne erkannte er düster Heimgarten, Herzogstand, Jochberg und Benediktenwand, dahinter schon sonnenbestrahlt das helle Grau des Karwendelgebirges mit einzelnen weiß leuchtenden Schneetupfern. Ein einsames Segelboot ruhte im See, sich kaum bewegend, zwischen Entenpaaren. Winzige Fische bewegten sich zitternd und hysterisch im Wasser neben einigen größeren, elegant die Weite des Sees auskostend. An Poths Ohren drang Vogelgezwitscher, unterbrochen von fernem Glockenläuten, am Sonntag die Gläubigen rufend. Vom Uferweg her hörte man das Knarzen der Schritte früh munterer Spaziergänger oder das gleichmäßige Geräusch vereinzelter Radfahrer, die, geschützt von Thujahecken, Herrn Poth nicht zu Gesicht bekamen.
Über der Einnahme des Frühstücks, der Absolvierung des Kirchganges und der Fernsehsendung „Internationaler Frühschoppen“ mit sechs Journalisten aus fünf Ländern unter der Moderation von Werner Höfer, war es Mittag geworden.
Konsul Poth hatte, bevor er sich an den unter einer Markise stehenden Glastisch, der für das Mittagessen mit Zinntellern gedeckt war, niederließ, die Rosen in seinem Garten inspiziert. Die Rosen waren von Poth eigenhändig ausgesucht worden. Nur alte Sorten mit einer gewissen Geschichte waren erwählt, wie die „Rose des Resht“, die aus Persien stammt, deren üppige Rosetten in tiefem Karminrot leuchten. Aber auch Sorten, deren Namen verführerisch klangen, etwa die schneeweiße „Boule de Neige“, bekamen ihre Chance. Konsul Poth bestellte bei einem bekannten Rosenzüchter jedes Jahr eine neue Sorte und wartete, ob sie sich in seinem Garten entwickelte. Erfolgreich war etwa die zartrosafarbene feine Schönheit mit Namen „La France“ vom Züchter Jean Baptiste Guillot mit der gefüllten kugeligen Blüte, ebenso wie die tiefbrombeerrote Strauchrose „Tuscany“, die schon 1596 erwähnt wurde, wie Konsul Poth Besuchern gerne erläuterte. Poth genoss vornehmlich das wahrhaft klerikale Violett der Rose „Cardinal de Richelieu“ und den verschwenderischen Duft der Kletterrosa „Gloier de Dijon“, deren goldgelbe dichte Blüten gefaltet sind wie ein Modell des Modeschöpfers Fortuny, den schon Proust zitierte. Poth ließ Besuchern gerne ihren, für alte Rosen so typisch intensiven Duft, mit dem der Damaszner Rose vergleichen, einer Rosenart seit der Antike als Sonnenanbeterin bekannt, mit noblem Wuchs und langen Blättern.
Der Garten war von einem renommierten Gartenarchitekten nach englischer Art angelegt. Der in einem eigenen kleinen Haus auf dem Grundstück wohnende Gärtner Pelz musste dafür sorgen, dass die Anlage, wie geplant, erhalten blieb.
Nach solchem sinnlichen Genuss des Auges und der Nase sollte der Gaumen verwöhnt werden. Am Mittagstisch der Familie des Konsul Dr. Poth, bestehend aus dem Konsul, dessen Gemahlin, deren älterer Schwester, im Familienkreis Tatte oder ansonsten auch Frau Majorin genannt, des Jesuitenpaters Herrn Dr. Müller und heute – es war eine Ausnahme, da sonst sonntags zumindest eine der drei Familien der Kinder der Poths eingeladen waren – lediglich des Enkels Paul, der mich, seinen Kameraden – auch dies für sonntags ungewöhnlich – zu Gast hatte, wurde von der seit Jahren im Hause wohnenden und „dienenden“ Köchin Anni gerade selbst das von ihr angefertigte Zitroneneis dargereicht. Normalerweise ließ sie die Hausmädchen Rosa oder Rosi servieren, aber das Eis brachte sie doch eigenhändig, wohl wissend, dass sie sich das Lob für das vorangegangene Essen – es gab nach der aus selbst gerupftem Sauerampfer hergestellten Suppe einen Ochsenschwanz – von Herrn Konsul abholen konnte und der Pater ihr, wie schon so oft, versichern würde, dass er allein des Eises wegen seinen Aufenthalt in Seeberg – dabei verdrehte Frau Poth unmerklich die Augen – ins, allerdings nicht theologisch gemeinte, Ewige ausdehnen könnte.
Herr Poth, als Unternehmer immer darauf bedacht, das Lob, das er bei seinen Mitarbeitern als Motivation regelmäßig verteilte, ohne dass ihm solches in Managementschulungen als günstige Art der Produktivitätssteigerung beigebracht worden wäre, nicht so ausgiebig einzusetzen, dass diese noch auf den Gedanken kämen, sie seien unersetzlich oder sollten daraus den Vorteil einer Gehaltserhöhung ziehen, lenkte doch bald die Aufmerksamkeit auf den dem Föhn geschuldeten Blick von der Terrasse auf den See und die Berge, mit allerdings mitfühlendem Seitenblick auf seine Gattin: „Ich weiß, der Föhn bereitet dir Kopfschmerzen, während er meine ästhetischen Genüsse befriedigt. Unser Pater würde sagen, das ist die Dialektik des Lebens, was den einen erfreut, ist der Schaden des anderen. Sollten wir uns wünschen, es gäbe keinen Föhn und wir müssten auf diese Blicke – wahre Naturschönheit – verzichten, aber andere kämen um körperliche Beschwerden herum? Was meinen Sie, mein lieber Jakob?“ Jakob Müller, der Jesuitenpater, griff das Thema auf, das wir nicht weiter verfolgen wollen, während Frau Poth sich der Köchin Anni annahm und sie aufforderte, sich an den Tisch zu setzen. Sie wollten die Speisefolge der nächsten Woche besprechen.
Paul und ich lauschten, wie so oft, dem Gespräch der Herren und, obwohl erst achtjährig, prägte sich uns doch vieles ein und wir diskutierten Jahre später manchmal über das Gesagte als doch typisch für Auffassungen, die kritisch zu hinterfragen wir uns angelegen sein ließen.
Auch jetzt. als ich Paul fast fünfzig Jahre später gegenübersaß und wir begannen, wenn auch aus traurigem Anlass, sein Leben zu resümieren, war sein erster Gedanke: „Wenn ich zurückdenke in die Fünfziger Jahre …“
3
Wäre dies der richtige Beginn?
Im Frühjahr 2007 gestand mir mein Freund Paul Poth, mit dem ich als Kind Räuber und Gendarm gespielt, mit dem ich als Schüler und Student gemeinsam „Ho Ho Ho Tschi Minh“ auf Demonstrationen, die für uns doch eher „Happenings“ waren, skandiert, mit dem ich zusammen in Harvard einen amerikanischen akademischen Abschluss erlangt hatte, für dessen erstes Kind ich Pate gestanden, dessen gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen ich juristisch begleitet habe, und dessen Firmenverkauf und damit die Möglichkeit, für sich, seine Frau und künftige Generationen, sofern diese die Vermögensverwaltung maßvoll und klug vornehmen ließen, ein wirtschaftlich sorgenfreies Leben zu führen, ich durchgeführt hatte, dass dank eines Gehirntumors sein Leben sich mit nun 57 Jahren demnächst beschließen werde. Da es ungewiss sei, wie lange seine geistigen Fähigkeiten noch vorhanden wären oder wie bald körperliche Unzulänglichkeiten alle auch geistige Aufmerksamkeiten benötigten, bat er mich, ihm so bald als möglich, wenn nicht täglich, so doch des Öfteren in der Woche für bis zu drei Stunden, zur Verfügung zu stehen. Er wolle sein Leben resümieren. Ich sei sein ältester und einer seiner wenigen wahren Freunde. Unser Vertrauensverhältnis gewährleiste, dass Mitteilungen, Gedanken, geäußerte Gefühle nicht dem Markt der Eitelkeiten und Geschwätzigkeit dargebracht werden. Es ginge nicht um eine Biographie und eine Darstellung für Nachgeborene. Er wolle nur mit sich selbst ins Reine kommen. Dazu sei das Gespräch – wie ja die Therapie wisse – ein geeignetes Mittel und besser als das Selbstgespräch, zumal wir selbst gemeinsam zahlreiche Diskussionen und Gespräche in allen Lebenszeiten und Lebenslagen hinter uns hätten.
Ich sagte selbstverständlich zu. Wir verabredeten uns für die zu vereinbarenden Tage von 17.00 bis 20.00 Uhr abends in meinen Kanzleiräumen in der Brienner Straße. Ich könnte für den völlig störungsfreien Ablauf garantieren. Ich ließ meine Termine umlegen oder sorgte für
Vertretung und wir begannen unsere Treffen drei Tage nach der Mitteilung der tödlichen Krankheit.
4
Denkbar wäre auch folgender Beginn:
Am 6. April 2008 gegen 14.00 Uhr war es in München so warm, wie in früheren Jahren gelegentlich im Juni oder September. Die Menschen, die an den im Freien aufgestellten Tischen des Cafés „Münchener Freiheit“ an dem gleichnamigen Platz in Schwabing saßen oder daran vorbeigingen, hatten sich der dem angeblich schon eingetretenen, obwohl bislang ständig verleugneten, Klimawandel geschuldeten Witterung in ihrer Kleidung angepasst. Diese war im Durchschnitt schicker und stilvoller – ein Urteil, das gewiss anmaßend ist, denn wer gibt vor, was schick und stilvoll ist? – als diejenige der Menschen in anderen deutschen Städten. Lag das daran, dass München näher an Italien liegt? Dort, wo die Menschen mehr von Geschmack und Stil verstehen. Lag es daran, dass die wiedererstellte Architektur vergangener Jahrhunderte Münchens, die, und das ist wohl fast Konsens, den schnell errichteten und lieblos zusammengestellten Gebäuden in den meisten Städten Deutschlands der Nachkriegszeit vorzuziehen ist, auf Stil und Geschmack der Bewohner abfärbte oder war es einfach eine Frage des Preises, des doch größeren und breiteren Wohlstandes in München als, sagen wir, Essen, Dortmund oder Mönchengladbach.
Ich war etwas zu früh, hatte Platz genommen und einen Milchkaffe mit viel Milch – in Wien „Verlängerter“ genannt – bei einer schwarzhaarigen Kellnerin mit eher ostischem Akzent – in Wien wäre es ein Kellner gewesen – als Latte macciato bestellt. Immerhin gab es, anders als in Wien mit seinem umfangreichen internationalen Zeitungsangebot, einige Lokalzeitungen zu lesen. Ich entschied mich, da ich die „Süddeutsche“ ohnehin abonniert hatte, für die „Abendzeitung“ und wurde im meinem schon bestehenden Urteil, das also ein Vorurteil war, erneut bestätigt, dass diese Zeitung in fünf Minuten zu lesen sei, dass, sei es dem Fernsehen, der aufgetretenen Konkurrenz oder der allgemeinen Nivellierung geschuldet, die Zeiten längst vorbei waren, als, dank Sigi Sommers originellen Geistesblitzen, dank „Hunters“ oder später Michael Gräters lokalen Ratschereien, dank witziger Karikaturen und Comics, die „Abendzeitung“ einem das Gefühl vermittelte, man könnte stolz darauf sein, als Münchener dazuzugehören. Heute dokumentiert die „Abendzeitung“ Münchener „Möchte gern“- Provinzialität, die, wie die schon lang nicht mehr authentischen Statements eines Herrn Hirnbeiss, allenfalls die Erinnerung an bessere Zeiten wahrt, während die „Bild“ immerhin vorgeben kann, dem Volk national aufs Maul geschaut zu haben.
Die notwendigen fünf Minuten waren noch nicht abgelaufen, als ich schon meinen Freund Paul, offenbar mich suchend, sah. Er ist circa ein Meter fünfundachtzig groß, hat beginnendes weißes, aber volles, noch blondes, links gescheiteltes kurzgeschnittenes Haar, ein ebenmäßiges, schönes Gesicht mit großen, blauen Augen, einer geraden Nase und breiten, sinnlichen Lippen. Er ist schlank und trägt eine randlose Brille, die sich dank des Sonnenscheines dunkel eingefärbt hatte.
Ich winkte, er bemerkte mich und setzte sich. „Ich freue mich. Wie geht’s?“
„Beschissen. Ich bin Opfer eines Gehirntumors und habe vielleicht noch drei Monate zu leben. Eine Operation ist nicht möglich. Noch kann ich denken, reden, mich bewegen. Das wird sich jedoch bald ändern. Ich weiß es seit gestern. Doch wollte ich unser Treffen dennoch wahrnehmen.“
5
Eine mögliche Variante zu beginnen, könnte so formuliert werden:
Als Realist war sich Paul Poth klar, dass er gelebt hatte, dass vor ihm eine dem reinen Überlebenswillen geschuldete, an sich sinnlose medizinisch indizierte Prozedur des Hinauszögerns des Todes durch Maßnahmen wie Bestrahlung, Chemotherapie und Medikation lag. Der verzögerte Exitus sollte sich auch möglichst schmerzfrei einstellen.
Dies war unvermeidlich und letztlich in den jeweiligen Schritten zwar nicht im Detail, aber doch im großen Ganzen vordefiniert. Was Paul Poth aber noch wollte und dies war der Akt der Freiheit, dies konnte er noch entscheiden und sich bewusst machen: Er wollte für sich klären, wie er gelebt hatte. Was hatte er richtig gemacht, was hatte er recht gemacht, was war unvermeidlich, was wäre, bei anderer Entscheidung seinerseits, vielleicht anders gegangen.
Er wollte sterben in dem Bewusstsein, nicht nur äußerlich testamentarisch seine Angelegenheiten geregelt zu haben, sondern sich selbst über sein Leben Rechenschaft abgelegt, sozusagen das Jüngste Gericht für sich vorgezogen zu haben.
Um dies zu realisieren, wandte er sich an mich, seinen ältesten Freund, um ihm als Sparringspartner oder als Therapeut gegenüberzustehen. Lange Zeit hatten wir als
Abiturienten und beginnende Studenten, anstatt früh schlafen zu gehen, darüber diskutiert, ob es das richtige Leben im falschen gäbe und wenn, wie ein solches zu formulieren wäre.
Wir verabredeten uns in meiner Kanzlei. Wir setzten unsere Gespräche auf mindestens dreimal wöchentlich, außer samstags und sonntags, um jeweils 17.00 Uhr fest und gaben uns maximal drei Stunden pro Tag.
6
Allen Potentialitäten zum Trotz muss doch eine Entscheidung, und die ist frei, zur Realität führen, in diesem Fall zum konkreten Beginn:
Südlich von München liegt, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft und vor sich in einigem Abstand, daher keineswegs erdrückend und einengend, die Nordalpenkette, der Starnberger See, im Gegensatz zum Ammersee, dem Bauernsee, auch Fürstensee genannt.
Offiziell ist der Name erst seit 1962 gültig, so dass zu der Zeit, in welcher ein Teil unserer Geschichte spielt, Würmsee die amtliche Bezeichnung wäre.
Am Starnberger See liegt auch das gleichnamige Städtchen, jedoch kein Wald oder gar ein Schloss mit diesem Namen. Dagegen gibt es viele Villen und Landhäuser, die wohlhabende Bürger sich in unterschiedlichsten Stilformen seit Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend – damit der Bahnlinie folgend – auf dem Westufer des Sees errichtet haben.
Auf dieser Seite des Sees, am nördlichen Ende einer Einbuchtung findet sich der Ort Seeberg und eine dieser Villen, in denen die Großeltern Paul Poths in zweiter Generation, man kann zu Recht sagen, residierten.
Denn die Villa „Seeblick“ lag inmitten eines Parks, der doch, wie der Name schon sagt, den Blick sowohl auf den See wie auf die Alpen und zuvörderst die Zugspitze freigab. Sie war von einem Münchener Architekten neuklassizistisch gebaut, was heißt, dass Stilelemente vergangener Epochen eklektisch zusammengesetzt wurden. In diesem Falle aber durchaus nicht protzig, neureich, sondern zurückgenommen mit Gefühl für Stil und Geschmack.
Der Vater von Konsul Dr. Poth war Kunsthändler und hatte einen angesehenen Architekten der Münchener Szene beauftragt, ihm ein angemessenes Landhaus zu planen und zu realisieren – zwölf Jahre nach der Fertigstellung seines Stadthauses in der Brienner Straße, in dessen zweitem Stock nun mein Anwaltsbüro eingerichtet war, das als Treffpunkt des Sich Bewusstmachens des gelebten Lebens meines Freundes Paul Poth diente.
7
Ich sage Freund. Ja, Paul Poth war und ist mein Freund.
Freundschaft speist sich aus gemeinsamen Erfahrungen, wie der Schulzeit oder Studentenzeit.
Wir hatten schon als Kleinkinder zusammen gespielt, als Schüler in der Oberstufe, obwohl an verschiedenen Gymnasien und verschiedenen Orten uns von einem Studenten der Germanistik, Mitglied der Rotzeg, der sogenannten Roten Zelle Germanistik, gemeinsam in Dialektik – derjenigen von Hegel als notwendiger Vorläufer von Karl Marx – schulen lassen. Wir hatten verschiedene Fächer an verschiedenen Unis studiert, ich in München Jura und nebenbei bei den Jesuiten Philosophie, Paul in Frankfurt Philosophie und Volkswirtschaft, aber gemeinsam dieselben enttäuschenden Erfahrungen mit den Ausläufern der Studentenbewegung gemacht, um uns im amerikanischen Cambridge an der Harvard Universität wiederzusehen: Paul machte den Master of Business Administration, ich den Master of Laws, den Legum Magister, den LL.M.
Wir arbeiteten auch später beruflich zusammen, als Paul als operativer Manager bei einem LBO, also einem „Leveraged Buyout“ oder heute populärer, einer Heuschreckenübernahme, agierte und ich die notwendigen Verträge ausfertigte. Wir sind gegenseitig Paten unserer Kinder, ich habe Pauls Ehe geschieden und war ihm in dieser für ihn sehr schweren Zeit mit vielen ausführlichen Gesprächen gewiss eine Stütze.
Wir haben eine gemeinsame Lebensauffassung, oder genauer, Haltung. Wir verabscheuen jegliche aufgesetzte Attitüde, sei sie intellektueller, geschäftlicher oder privater Art. Insofern haben wir ein durchaus so zu bezeichnendes elitäres Selbstverständnis, dessen Charakteristikum es aber gerade ist, es nicht nach außen zu tragen. Gemeinsam können wir uns dann bestens amüsieren über die Eitelkeiten und aufgeblasenen Sprüche sogenannter Leistungsträger, deren Erfolg immer wieder verwunderlich erscheint.
All das genügt aber nicht für eine Freundschaft. Hinzu müssen intellektuelle Gemeinsamkeiten kommen, die wiederum aus den Studieninhalten stammen können, aber auch aus gemeinsamen Vorlieben für bestimmte Literatur, Kunst oder sonstiges.
In unserem Fall war es die Vorliebe für gewisse Romane. Paul und ich liebten Proust, Thomas Mann, Fontane, Flaubert, aber auch Musil, Joyce und nicht zuletzt die Lebensweisheiten eines Shakespeares.
Wir waren uns einig, dass von den aktuellen Autoren allenfalls Philipp Roth, trotz seiner uns beide störende „Sexsucht“, an diese heranreichte. Dass er noch keinen Nobelpreis erhalten hatte und ihm etwa die Österreicherin Jelinek vorgezogen wurde, hielten wir für einen Skandal.
Da wir beide ständig Bücher der genannten Autoren lasen, teilten wir uns bei regelmäßigen gemeinsamen Treffen immer wieder kleine Details mit, wie „Ich habe neulich in der ‚Gefangenen‘, dem 5. Band der ‚Recherche‘, einen Hinweis auf den möglichen Namen des Erzählers gefunden, indem Albertine unter der Prämisse dem Erzähler denselben Namen wie dem Verfasser zu geben, welch ironische Distanzierung, diesen ,Mein Marcel‘ oder ,Marcel Liebling‘ nannte“, oder „Was Fontane den alten Stechlin über das Telegraphieren sagen lässt, könnte man heutzutage auf die E-Mail Sucht anwenden:,Die feinere Sitte leidet ganz gewiss‘.“ Solche Hinweise gingen über in Diskussionen zu Fragen, wie generell geltende Wahrheiten von Romanen oder inwieweit der Roman oder die Kunst allgemein und nur diese gelebtes Leben verewige.
Wahre Freundschaft wird erst in fortgeschrittenem Alter bewusst. Mit dem Freunde konnte man Dinge besprechen intimster Art und war doch gesichert, dass die Kenntnisse weder im unmittelbaren Gespräch als Waffe, wie allzu oft in Liebesbeziehungen, noch im Bekanntenkreis als Geschwätz verwendet wurden. Durch gemeinsame Erfahrung und intellektuelle Übereinstimmung war man sich des Verständnisses gewiss. Schwach sich zu zeigen, ohne Stärke zu provozieren, ist Zeichen der Freundschaft, nicht der Liebe. Die Liebe ist, und das wusste Proust so viel besser als Adorno, besitzergreifend und als solche immer in Machtkämpfe verstrickt. Dem entgeht die wahre Freundschaft.
In unserem Fall waren wir uns auch einig in Grundansichten zur Philosophie. Ich teilte die Auffassung von Paul, der Philosophie akademisch mit dem Doktortitel abgeschlossen hatte, dass das alte Diktum von Seneca, die Philosophie verheiße dem Menschengeschlecht „Guten Rat“ nicht mehr gelte. Die Philosophie wolle Erkenntnis. Aber diese war für den Normalbürger heute nicht mehr philosophisch vermittelbar, was die Philosophen schon immer wussten, angefangen von Sokrates Wissen darum, dass er nichts wisse, bis zu Max Horkheimers Eingeständnis, dass derjenige, der zu Philosophieren beginne vor der Erfahrung nicht sicher sei, dass seine Unternehmung widersinnig sei.
Was ist das aber für ein Rat an die Menschheit: Wir wissen nichts und unsere Aussagen sind widersinnig. Daher käme es nach unserer Überzeugung heute den großen Romanschriftstellern zu, in ihren Romanen Handlungsmodelle und damit auch Rat darzutun, ohne mit gehobenem Zeigefinger abstrakte Vorstellungen zu vermitteln und ohne auf die Schwierigkeiten und Widersprüche, die nun einmal menschliches Dasein impliziere, zu verzichten. In der Auseinandersetzung mit gelebtem und in Romanform dargestelltem Leben könne das moderne Individuum für seine individuelle Lebensform Anschauung und damit Rat erfahren.
„Lerne im Leben die Kunst,
im Kunstwerk lerne das Leben.“
Friedrich Hölderlin
1
Wie beginnen?
Sollten wir unsere Erzählung über, sagen wir Paul Poth, wir könnten ihn aber auch, da Namen in Romanen oft ablenken oder zu falschen Assoziationen verleiten, abkürzen: P. P. – was doch mehr ist als das Niemand Homers – oder wohlklingend, aber etwas altertümlich und gekünstelt, Adrian oder, gut Deutsch, Ulrich oder Waldemar – das bayerische Woldemar – Starnberg, da unsere Geschichte auch an dem gleichnamigen See spielt, oder aristokratisch bayerisch Leopold oder francophon Frederic oder gar jüdisch, Gott hat gegeben, Nathan benennen, unseren Helden, der doch ein ziemlich gelungenes und erfreuliches, wenn auch nicht immer geradliniges, von manchen Brüchen, wie einer Ehescheidung, bestimmtes, aber ansonsten ein Leben führte, verschont von größeren Katastrophen – bis auf die eine, die Anlass dieses Berichtes wurde, die Diagnose einer im Regelfall tödlich verlaufenden Krankheit im Alter von Ende fünfzig kann man heutzutage schon als solche für den Betroffenen bezeichnen, ein Leben, welches dem gesellschaftlichen und politischen Umfeld, das sich friedvoll und geduldig entwickelte, entsprach, damit beginnen, uns selbst vorzustellen? Wohl wissend, dass das Erzählte durch die Sichtweise des Erzählenden, durch dessen Aus- und Wortwahl eben auch von diesem handelt, dass das Wissen, das Wer und Was des Schreibenden das Geschriebene verständlicher werden lässt, jedenfalls relativiert.
Wenn wir das täten, so wäre zu berichten, dass Paul Poth, für diesen Namen haben wir uns nun offensichtlich entschieden, dem Verfasser schon als Kind bekannt war, und dass der Erzähler die Ehre hat, sich bis zum heutigen Tag zu dessen Freunden zählen zu dürfen. Gemeinsam verbrachte Zeiten in der Kindheit, Jugend und als Studenten, gemeinsames
Auslandsstudium, wechselseitige Trauzeugen- und Patenschaften haben diese Freundschaft bestätigt und erlauben es, die folgenden Zeilen zu verantworten.
2
Sollten wir so beginnen: Von Süden wehte ein warmer, trockener Wind – der Föhn, den die Römer wohlklingend favonius nannten. Der Himmel war klar und die geringe Luftfeuchtigkeit des Föhns offenbarte einen herrlichen Blick vom parkähnlichen Garten des Herrn Konsul Dr. Poth auf die Alpenkette, aus der die Zugspitze herausragte. Es war ein schöner Julitag des Jahres 1959.
Der Starnberger See war, auch sonntags, noch nicht bedeckt von einem Meer weißer Segel, das Gefühl von Wind, Wasser und Bewegung auf ständige Ausweichmanöver reduzierend. Der See war ein hellblauer Farbfleck in weitem grünen Rund, mit einzelnen weißen Tupfern. Von dem Dorf Seeberg gab der Blick aus dem Wohnzimmer der Villa Poths in erster Linie die neubarocken Kirchtürme frei. Anders als vielleicht manche Städte war Seeberg nicht an dessen Gang zu erkennen, da zu dieser Mittagszeit so gut wie nichts in Bewegung war.
Der Möbelfabrikant und Kunsthändler Poth hatte, seiner Gewohnheit folgend, den Sonntagmorgen mit einem Bad im Starnberger See begonnen. Er benutzte dazu seine Badehütte, die vom Ufer aus in den See gebaut war und ihm einen exklusiven Seezugang ermöglichte. Er tauchte in die glatte Wasserfläche. Das Wasser war angenehm, um die dreiundzwanzig Grad und dennoch am Morgen erfrischend. Sein Blick war frei auf das andere Seeufer, noch nicht wie heutzutage durch zahlreiche Bojen und daran hängende abgetakelte Segelboote verstellt. Die gegenüberliegenden Türme des Ammerlander Schlosses, das einst dem Grafen Pocci gehörte, waren gegen die tiefstehende, aber schon warme Sonne nur schemenhaft wahrzunehmen. In der südlichen Ferne erkannte er düster Heimgarten, Herzogstand, Jochberg und Benediktenwand, dahinter schon sonnenbestrahlt das helle Grau des Karwendelgebirges mit einzelnen weiß leuchtenden Schneetupfern. Ein einsames Segelboot ruhte im See, sich kaum bewegend, zwischen Entenpaaren. Winzige Fische bewegten sich zitternd und hysterisch im Wasser neben einigen größeren, elegant die Weite des Sees auskostend. An Poths Ohren drang Vogelgezwitscher, unterbrochen von fernem Glockenläuten, am Sonntag die Gläubigen rufend. Vom Uferweg her hörte man das Knarzen der Schritte früh munterer Spaziergänger oder das gleichmäßige Geräusch vereinzelter Radfahrer, die, geschützt von Thujahecken, Herrn Poth nicht zu Gesicht bekamen.
Über der Einnahme des Frühstücks, der Absolvierung des Kirchganges und der Fernsehsendung „Internationaler Frühschoppen“ mit sechs Journalisten aus fünf Ländern unter der Moderation von Werner Höfer, war es Mittag geworden.
Konsul Poth hatte, bevor er sich an den unter einer Markise stehenden Glastisch, der für das Mittagessen mit Zinntellern gedeckt war, niederließ, die Rosen in seinem Garten inspiziert. Die Rosen waren von Poth eigenhändig ausgesucht worden. Nur alte Sorten mit einer gewissen Geschichte waren erwählt, wie die „Rose des Resht“, die aus Persien stammt, deren üppige Rosetten in tiefem Karminrot leuchten. Aber auch Sorten, deren Namen verführerisch klangen, etwa die schneeweiße „Boule de Neige“, bekamen ihre Chance. Konsul Poth bestellte bei einem bekannten Rosenzüchter jedes Jahr eine neue Sorte und wartete, ob sie sich in seinem Garten entwickelte. Erfolgreich war etwa die zartrosafarbene feine Schönheit mit Namen „La France“ vom Züchter Jean Baptiste Guillot mit der gefüllten kugeligen Blüte, ebenso wie die tiefbrombeerrote Strauchrose „Tuscany“, die schon 1596 erwähnt wurde, wie Konsul Poth Besuchern gerne erläuterte. Poth genoss vornehmlich das wahrhaft klerikale Violett der Rose „Cardinal de Richelieu“ und den verschwenderischen Duft der Kletterrosa „Gloier de Dijon“, deren goldgelbe dichte Blüten gefaltet sind wie ein Modell des Modeschöpfers Fortuny, den schon Proust zitierte. Poth ließ Besuchern gerne ihren, für alte Rosen so typisch intensiven Duft, mit dem der Damaszner Rose vergleichen, einer Rosenart seit der Antike als Sonnenanbeterin bekannt, mit noblem Wuchs und langen Blättern.
Der Garten war von einem renommierten Gartenarchitekten nach englischer Art angelegt. Der in einem eigenen kleinen Haus auf dem Grundstück wohnende Gärtner Pelz musste dafür sorgen, dass die Anlage, wie geplant, erhalten blieb.
Nach solchem sinnlichen Genuss des Auges und der Nase sollte der Gaumen verwöhnt werden. Am Mittagstisch der Familie des Konsul Dr. Poth, bestehend aus dem Konsul, dessen Gemahlin, deren älterer Schwester, im Familienkreis Tatte oder ansonsten auch Frau Majorin genannt, des Jesuitenpaters Herrn Dr. Müller und heute – es war eine Ausnahme, da sonst sonntags zumindest eine der drei Familien der Kinder der Poths eingeladen waren – lediglich des Enkels Paul, der mich, seinen Kameraden – auch dies für sonntags ungewöhnlich – zu Gast hatte, wurde von der seit Jahren im Hause wohnenden und „dienenden“ Köchin Anni gerade selbst das von ihr angefertigte Zitroneneis dargereicht. Normalerweise ließ sie die Hausmädchen Rosa oder Rosi servieren, aber das Eis brachte sie doch eigenhändig, wohl wissend, dass sie sich das Lob für das vorangegangene Essen – es gab nach der aus selbst gerupftem Sauerampfer hergestellten Suppe einen Ochsenschwanz – von Herrn Konsul abholen konnte und der Pater ihr, wie schon so oft, versichern würde, dass er allein des Eises wegen seinen Aufenthalt in Seeberg – dabei verdrehte Frau Poth unmerklich die Augen – ins, allerdings nicht theologisch gemeinte, Ewige ausdehnen könnte.
Herr Poth, als Unternehmer immer darauf bedacht, das Lob, das er bei seinen Mitarbeitern als Motivation regelmäßig verteilte, ohne dass ihm solches in Managementschulungen als günstige Art der Produktivitätssteigerung beigebracht worden wäre, nicht so ausgiebig einzusetzen, dass diese noch auf den Gedanken kämen, sie seien unersetzlich oder sollten daraus den Vorteil einer Gehaltserhöhung ziehen, lenkte doch bald die Aufmerksamkeit auf den dem Föhn geschuldeten Blick von der Terrasse auf den See und die Berge, mit allerdings mitfühlendem Seitenblick auf seine Gattin: „Ich weiß, der Föhn bereitet dir Kopfschmerzen, während er meine ästhetischen Genüsse befriedigt. Unser Pater würde sagen, das ist die Dialektik des Lebens, was den einen erfreut, ist der Schaden des anderen. Sollten wir uns wünschen, es gäbe keinen Föhn und wir müssten auf diese Blicke – wahre Naturschönheit – verzichten, aber andere kämen um körperliche Beschwerden herum? Was meinen Sie, mein lieber Jakob?“ Jakob Müller, der Jesuitenpater, griff das Thema auf, das wir nicht weiter verfolgen wollen, während Frau Poth sich der Köchin Anni annahm und sie aufforderte, sich an den Tisch zu setzen. Sie wollten die Speisefolge der nächsten Woche besprechen.
Paul und ich lauschten, wie so oft, dem Gespräch der Herren und, obwohl erst achtjährig, prägte sich uns doch vieles ein und wir diskutierten Jahre später manchmal über das Gesagte als doch typisch für Auffassungen, die kritisch zu hinterfragen wir uns angelegen sein ließen.
Auch jetzt. als ich Paul fast fünfzig Jahre später gegenübersaß und wir begannen, wenn auch aus traurigem Anlass, sein Leben zu resümieren, war sein erster Gedanke: „Wenn ich zurückdenke in die Fünfziger Jahre …“
3
Wäre dies der richtige Beginn?
Im Frühjahr 2007 gestand mir mein Freund Paul Poth, mit dem ich als Kind Räuber und Gendarm gespielt, mit dem ich als Schüler und Student gemeinsam „Ho Ho Ho Tschi Minh“ auf Demonstrationen, die für uns doch eher „Happenings“ waren, skandiert, mit dem ich zusammen in Harvard einen amerikanischen akademischen Abschluss erlangt hatte, für dessen erstes Kind ich Pate gestanden, dessen gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen ich juristisch begleitet habe, und dessen Firmenverkauf und damit die Möglichkeit, für sich, seine Frau und künftige Generationen, sofern diese die Vermögensverwaltung maßvoll und klug vornehmen ließen, ein wirtschaftlich sorgenfreies Leben zu führen, ich durchgeführt hatte, dass dank eines Gehirntumors sein Leben sich mit nun 57 Jahren demnächst beschließen werde. Da es ungewiss sei, wie lange seine geistigen Fähigkeiten noch vorhanden wären oder wie bald körperliche Unzulänglichkeiten alle auch geistige Aufmerksamkeiten benötigten, bat er mich, ihm so bald als möglich, wenn nicht täglich, so doch des Öfteren in der Woche für bis zu drei Stunden, zur Verfügung zu stehen. Er wolle sein Leben resümieren. Ich sei sein ältester und einer seiner wenigen wahren Freunde. Unser Vertrauensverhältnis gewährleiste, dass Mitteilungen, Gedanken, geäußerte Gefühle nicht dem Markt der Eitelkeiten und Geschwätzigkeit dargebracht werden. Es ginge nicht um eine Biographie und eine Darstellung für Nachgeborene. Er wolle nur mit sich selbst ins Reine kommen. Dazu sei das Gespräch – wie ja die Therapie wisse – ein geeignetes Mittel und besser als das Selbstgespräch, zumal wir selbst gemeinsam zahlreiche Diskussionen und Gespräche in allen Lebenszeiten und Lebenslagen hinter uns hätten.
Ich sagte selbstverständlich zu. Wir verabredeten uns für die zu vereinbarenden Tage von 17.00 bis 20.00 Uhr abends in meinen Kanzleiräumen in der Brienner Straße. Ich könnte für den völlig störungsfreien Ablauf garantieren. Ich ließ meine Termine umlegen oder sorgte für
Vertretung und wir begannen unsere Treffen drei Tage nach der Mitteilung der tödlichen Krankheit.
4
Denkbar wäre auch folgender Beginn:
Am 6. April 2008 gegen 14.00 Uhr war es in München so warm, wie in früheren Jahren gelegentlich im Juni oder September. Die Menschen, die an den im Freien aufgestellten Tischen des Cafés „Münchener Freiheit“ an dem gleichnamigen Platz in Schwabing saßen oder daran vorbeigingen, hatten sich der dem angeblich schon eingetretenen, obwohl bislang ständig verleugneten, Klimawandel geschuldeten Witterung in ihrer Kleidung angepasst. Diese war im Durchschnitt schicker und stilvoller – ein Urteil, das gewiss anmaßend ist, denn wer gibt vor, was schick und stilvoll ist? – als diejenige der Menschen in anderen deutschen Städten. Lag das daran, dass München näher an Italien liegt? Dort, wo die Menschen mehr von Geschmack und Stil verstehen. Lag es daran, dass die wiedererstellte Architektur vergangener Jahrhunderte Münchens, die, und das ist wohl fast Konsens, den schnell errichteten und lieblos zusammengestellten Gebäuden in den meisten Städten Deutschlands der Nachkriegszeit vorzuziehen ist, auf Stil und Geschmack der Bewohner abfärbte oder war es einfach eine Frage des Preises, des doch größeren und breiteren Wohlstandes in München als, sagen wir, Essen, Dortmund oder Mönchengladbach.
Ich war etwas zu früh, hatte Platz genommen und einen Milchkaffe mit viel Milch – in Wien „Verlängerter“ genannt – bei einer schwarzhaarigen Kellnerin mit eher ostischem Akzent – in Wien wäre es ein Kellner gewesen – als Latte macciato bestellt. Immerhin gab es, anders als in Wien mit seinem umfangreichen internationalen Zeitungsangebot, einige Lokalzeitungen zu lesen. Ich entschied mich, da ich die „Süddeutsche“ ohnehin abonniert hatte, für die „Abendzeitung“ und wurde im meinem schon bestehenden Urteil, das also ein Vorurteil war, erneut bestätigt, dass diese Zeitung in fünf Minuten zu lesen sei, dass, sei es dem Fernsehen, der aufgetretenen Konkurrenz oder der allgemeinen Nivellierung geschuldet, die Zeiten längst vorbei waren, als, dank Sigi Sommers originellen Geistesblitzen, dank „Hunters“ oder später Michael Gräters lokalen Ratschereien, dank witziger Karikaturen und Comics, die „Abendzeitung“ einem das Gefühl vermittelte, man könnte stolz darauf sein, als Münchener dazuzugehören. Heute dokumentiert die „Abendzeitung“ Münchener „Möchte gern“- Provinzialität, die, wie die schon lang nicht mehr authentischen Statements eines Herrn Hirnbeiss, allenfalls die Erinnerung an bessere Zeiten wahrt, während die „Bild“ immerhin vorgeben kann, dem Volk national aufs Maul geschaut zu haben.
Die notwendigen fünf Minuten waren noch nicht abgelaufen, als ich schon meinen Freund Paul, offenbar mich suchend, sah. Er ist circa ein Meter fünfundachtzig groß, hat beginnendes weißes, aber volles, noch blondes, links gescheiteltes kurzgeschnittenes Haar, ein ebenmäßiges, schönes Gesicht mit großen, blauen Augen, einer geraden Nase und breiten, sinnlichen Lippen. Er ist schlank und trägt eine randlose Brille, die sich dank des Sonnenscheines dunkel eingefärbt hatte.
Ich winkte, er bemerkte mich und setzte sich. „Ich freue mich. Wie geht’s?“
„Beschissen. Ich bin Opfer eines Gehirntumors und habe vielleicht noch drei Monate zu leben. Eine Operation ist nicht möglich. Noch kann ich denken, reden, mich bewegen. Das wird sich jedoch bald ändern. Ich weiß es seit gestern. Doch wollte ich unser Treffen dennoch wahrnehmen.“
5
Eine mögliche Variante zu beginnen, könnte so formuliert werden:
Als Realist war sich Paul Poth klar, dass er gelebt hatte, dass vor ihm eine dem reinen Überlebenswillen geschuldete, an sich sinnlose medizinisch indizierte Prozedur des Hinauszögerns des Todes durch Maßnahmen wie Bestrahlung, Chemotherapie und Medikation lag. Der verzögerte Exitus sollte sich auch möglichst schmerzfrei einstellen.
Dies war unvermeidlich und letztlich in den jeweiligen Schritten zwar nicht im Detail, aber doch im großen Ganzen vordefiniert. Was Paul Poth aber noch wollte und dies war der Akt der Freiheit, dies konnte er noch entscheiden und sich bewusst machen: Er wollte für sich klären, wie er gelebt hatte. Was hatte er richtig gemacht, was hatte er recht gemacht, was war unvermeidlich, was wäre, bei anderer Entscheidung seinerseits, vielleicht anders gegangen.
Er wollte sterben in dem Bewusstsein, nicht nur äußerlich testamentarisch seine Angelegenheiten geregelt zu haben, sondern sich selbst über sein Leben Rechenschaft abgelegt, sozusagen das Jüngste Gericht für sich vorgezogen zu haben.
Um dies zu realisieren, wandte er sich an mich, seinen ältesten Freund, um ihm als Sparringspartner oder als Therapeut gegenüberzustehen. Lange Zeit hatten wir als
Abiturienten und beginnende Studenten, anstatt früh schlafen zu gehen, darüber diskutiert, ob es das richtige Leben im falschen gäbe und wenn, wie ein solches zu formulieren wäre.
Wir verabredeten uns in meiner Kanzlei. Wir setzten unsere Gespräche auf mindestens dreimal wöchentlich, außer samstags und sonntags, um jeweils 17.00 Uhr fest und gaben uns maximal drei Stunden pro Tag.
6
Allen Potentialitäten zum Trotz muss doch eine Entscheidung, und die ist frei, zur Realität führen, in diesem Fall zum konkreten Beginn:
Südlich von München liegt, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft und vor sich in einigem Abstand, daher keineswegs erdrückend und einengend, die Nordalpenkette, der Starnberger See, im Gegensatz zum Ammersee, dem Bauernsee, auch Fürstensee genannt.
Offiziell ist der Name erst seit 1962 gültig, so dass zu der Zeit, in welcher ein Teil unserer Geschichte spielt, Würmsee die amtliche Bezeichnung wäre.
Am Starnberger See liegt auch das gleichnamige Städtchen, jedoch kein Wald oder gar ein Schloss mit diesem Namen. Dagegen gibt es viele Villen und Landhäuser, die wohlhabende Bürger sich in unterschiedlichsten Stilformen seit Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend – damit der Bahnlinie folgend – auf dem Westufer des Sees errichtet haben.
Auf dieser Seite des Sees, am nördlichen Ende einer Einbuchtung findet sich der Ort Seeberg und eine dieser Villen, in denen die Großeltern Paul Poths in zweiter Generation, man kann zu Recht sagen, residierten.
Denn die Villa „Seeblick“ lag inmitten eines Parks, der doch, wie der Name schon sagt, den Blick sowohl auf den See wie auf die Alpen und zuvörderst die Zugspitze freigab. Sie war von einem Münchener Architekten neuklassizistisch gebaut, was heißt, dass Stilelemente vergangener Epochen eklektisch zusammengesetzt wurden. In diesem Falle aber durchaus nicht protzig, neureich, sondern zurückgenommen mit Gefühl für Stil und Geschmack.
Der Vater von Konsul Dr. Poth war Kunsthändler und hatte einen angesehenen Architekten der Münchener Szene beauftragt, ihm ein angemessenes Landhaus zu planen und zu realisieren – zwölf Jahre nach der Fertigstellung seines Stadthauses in der Brienner Straße, in dessen zweitem Stock nun mein Anwaltsbüro eingerichtet war, das als Treffpunkt des Sich Bewusstmachens des gelebten Lebens meines Freundes Paul Poth diente.
7
Ich sage Freund. Ja, Paul Poth war und ist mein Freund.
Freundschaft speist sich aus gemeinsamen Erfahrungen, wie der Schulzeit oder Studentenzeit.
Wir hatten schon als Kleinkinder zusammen gespielt, als Schüler in der Oberstufe, obwohl an verschiedenen Gymnasien und verschiedenen Orten uns von einem Studenten der Germanistik, Mitglied der Rotzeg, der sogenannten Roten Zelle Germanistik, gemeinsam in Dialektik – derjenigen von Hegel als notwendiger Vorläufer von Karl Marx – schulen lassen. Wir hatten verschiedene Fächer an verschiedenen Unis studiert, ich in München Jura und nebenbei bei den Jesuiten Philosophie, Paul in Frankfurt Philosophie und Volkswirtschaft, aber gemeinsam dieselben enttäuschenden Erfahrungen mit den Ausläufern der Studentenbewegung gemacht, um uns im amerikanischen Cambridge an der Harvard Universität wiederzusehen: Paul machte den Master of Business Administration, ich den Master of Laws, den Legum Magister, den LL.M.
Wir arbeiteten auch später beruflich zusammen, als Paul als operativer Manager bei einem LBO, also einem „Leveraged Buyout“ oder heute populärer, einer Heuschreckenübernahme, agierte und ich die notwendigen Verträge ausfertigte. Wir sind gegenseitig Paten unserer Kinder, ich habe Pauls Ehe geschieden und war ihm in dieser für ihn sehr schweren Zeit mit vielen ausführlichen Gesprächen gewiss eine Stütze.
Wir haben eine gemeinsame Lebensauffassung, oder genauer, Haltung. Wir verabscheuen jegliche aufgesetzte Attitüde, sei sie intellektueller, geschäftlicher oder privater Art. Insofern haben wir ein durchaus so zu bezeichnendes elitäres Selbstverständnis, dessen Charakteristikum es aber gerade ist, es nicht nach außen zu tragen. Gemeinsam können wir uns dann bestens amüsieren über die Eitelkeiten und aufgeblasenen Sprüche sogenannter Leistungsträger, deren Erfolg immer wieder verwunderlich erscheint.
All das genügt aber nicht für eine Freundschaft. Hinzu müssen intellektuelle Gemeinsamkeiten kommen, die wiederum aus den Studieninhalten stammen können, aber auch aus gemeinsamen Vorlieben für bestimmte Literatur, Kunst oder sonstiges.
In unserem Fall war es die Vorliebe für gewisse Romane. Paul und ich liebten Proust, Thomas Mann, Fontane, Flaubert, aber auch Musil, Joyce und nicht zuletzt die Lebensweisheiten eines Shakespeares.
Wir waren uns einig, dass von den aktuellen Autoren allenfalls Philipp Roth, trotz seiner uns beide störende „Sexsucht“, an diese heranreichte. Dass er noch keinen Nobelpreis erhalten hatte und ihm etwa die Österreicherin Jelinek vorgezogen wurde, hielten wir für einen Skandal.
Da wir beide ständig Bücher der genannten Autoren lasen, teilten wir uns bei regelmäßigen gemeinsamen Treffen immer wieder kleine Details mit, wie „Ich habe neulich in der ‚Gefangenen‘, dem 5. Band der ‚Recherche‘, einen Hinweis auf den möglichen Namen des Erzählers gefunden, indem Albertine unter der Prämisse dem Erzähler denselben Namen wie dem Verfasser zu geben, welch ironische Distanzierung, diesen ,Mein Marcel‘ oder ,Marcel Liebling‘ nannte“, oder „Was Fontane den alten Stechlin über das Telegraphieren sagen lässt, könnte man heutzutage auf die E-Mail Sucht anwenden:,Die feinere Sitte leidet ganz gewiss‘.“ Solche Hinweise gingen über in Diskussionen zu Fragen, wie generell geltende Wahrheiten von Romanen oder inwieweit der Roman oder die Kunst allgemein und nur diese gelebtes Leben verewige.
Wahre Freundschaft wird erst in fortgeschrittenem Alter bewusst. Mit dem Freunde konnte man Dinge besprechen intimster Art und war doch gesichert, dass die Kenntnisse weder im unmittelbaren Gespräch als Waffe, wie allzu oft in Liebesbeziehungen, noch im Bekanntenkreis als Geschwätz verwendet wurden. Durch gemeinsame Erfahrung und intellektuelle Übereinstimmung war man sich des Verständnisses gewiss. Schwach sich zu zeigen, ohne Stärke zu provozieren, ist Zeichen der Freundschaft, nicht der Liebe. Die Liebe ist, und das wusste Proust so viel besser als Adorno, besitzergreifend und als solche immer in Machtkämpfe verstrickt. Dem entgeht die wahre Freundschaft.
In unserem Fall waren wir uns auch einig in Grundansichten zur Philosophie. Ich teilte die Auffassung von Paul, der Philosophie akademisch mit dem Doktortitel abgeschlossen hatte, dass das alte Diktum von Seneca, die Philosophie verheiße dem Menschengeschlecht „Guten Rat“ nicht mehr gelte. Die Philosophie wolle Erkenntnis. Aber diese war für den Normalbürger heute nicht mehr philosophisch vermittelbar, was die Philosophen schon immer wussten, angefangen von Sokrates Wissen darum, dass er nichts wisse, bis zu Max Horkheimers Eingeständnis, dass derjenige, der zu Philosophieren beginne vor der Erfahrung nicht sicher sei, dass seine Unternehmung widersinnig sei.
Was ist das aber für ein Rat an die Menschheit: Wir wissen nichts und unsere Aussagen sind widersinnig. Daher käme es nach unserer Überzeugung heute den großen Romanschriftstellern zu, in ihren Romanen Handlungsmodelle und damit auch Rat darzutun, ohne mit gehobenem Zeigefinger abstrakte Vorstellungen zu vermitteln und ohne auf die Schwierigkeiten und Widersprüche, die nun einmal menschliches Dasein impliziere, zu verzichten. In der Auseinandersetzung mit gelebtem und in Romanform dargestelltem Leben könne das moderne Individuum für seine individuelle Lebensform Anschauung und damit Rat erfahren.