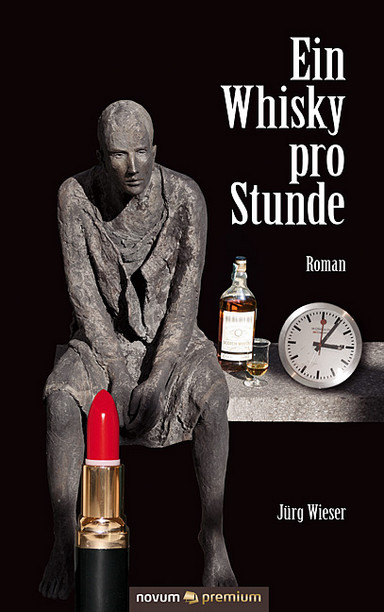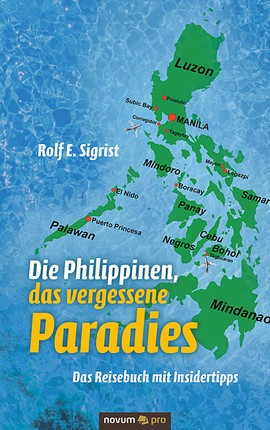Ein Whisky pro Stunde
Roman
Jürg Wieser
Leseprobe:
Werner Müller, vorzeitig in Rente geschickter ehemaliger Geschäftsführer eines mittelgroßen Industriebetriebes, schwamm die achtundvierzigste Runde in seinem Swimmingpool. Fünfzig Runden waren das tägliche Soll. Heute bereitete ihm das Schwimmen besondere Freude. Einerseits hatte das Wasser die für ihn ideale Temperatur von neunundzwanzig Grad Celsius und andererseits, noch angenehmer, beobachtete Brigitta aus den Augenwinkeln seine sportliche Leistung. Brigitta war die beste Freundin seiner Frau Käthi, fünfundvierzig Jahre jung, Primarschullehrerin, parteilos und politisch eher links stehend, während er sich zum rechten Flügel der FDP zählte. Mit Brigitta konnte er stundenlang diskutieren, auch heftig streiten. In praktisch allen Fragen des Alltags waren sie gegenteiliger Meinung und dennoch mochten sie sich beide sehr.
Brigitta genoss ihre freien Nachmittage im Sommer gerne bei Müllers. Der wunderschön gepflegte Garten bot totale Privatsphäre, was ihr erlaubte, sich auch oben ohne zu sonnen. Für sie bedeutete das Lebensqualität, totale Freiheit. Ihr Glücksgefühl erreichte ein beinahe orgiastisches Ausmaß, wenn sie sich dazu einen Wodka Mojito gönnte. Mit viel Liebe rührte sie zwei Teelöffel Zucker in Limettensaft in einem eisgekühlten Glas, gab zwei Pfefferminzblätter dazu, etwas zerstoßenes Eis, einen Schluck Mineralwasser und doppelt so viel Beluga wie Limettensaft. Käthi konnte Brigittas Begeisterung für das „Wässerchen aus Kartoffeln“ nicht nachvollziehen. Bitter Lemon und ein Eiswürfel genügten ihr, war weniger aufwendig in der Zubereitung und enthielt vor allem wenig Alkohol, den sie beim Sonnenbaden schlecht ertragen konnte.
Es war ein Bild zum Verlieben: Brigitta auf der weißen Sonnenliege, versehen mit einem dicken blauen Polster, das Rückenteil hochgestellt, ihre prallen, braunen Brüste in der Sonne glänzend, die Brustwarzen keck hervortretend. Das postautogelbe Röhrchen, durch das sie den Wodka schlürfte, beinahe kitschig zu ihren roten Lippen und blendend weißen Zähnen. „He Masochist, wie lange stählst du deinen Waschbrettbauch noch?“, rief sie Werner zu. „Zwei Runden noch, du darfst aufsitzen.“ Brigitta, inzwischen aufgestanden, prüfte die Wassertemperatur, goss sich – statt zu Duschen – als symbolische Geste eine Handvoll Wasser über ihre Brüste und glitt ins Wasser. „Jetzt spielen wir Frosch“, meinte sie, krabbelte auf seinen Rücken und ließ sich durchs Bassin ziehen. „Bei den Fröschen ist aber das Männchen oben“, monierte Werner, tauchte ab und klammerte sich nun seinerseits auf ihrem Rücken fest. Er drückte sein mittlerweile leicht erigiertes Glied gegen ihre Pospalte, worauf Brigitta mit einem Arm nach hinten griff und mit der Hand in seiner Badehose landete. „Keine schlechte Reaktion für dein Alter, Papi“, flüsterte sie und schwamm davon. Versammelt auf den Liegestühlen liebten sie es, in Zeitschriften zu schmökern (was immer wieder zu gutem Gesprächsstoff führte) oder einfach den Garten zu betrachten, den Blick in die weite Landschaft zu genießen.
„Du bist für mich der Epikur des 21. Jahrhunderts“, sagte Brigitta zu Werner. „Was meinst du damit?“, fragte er. „Weißt du, dieser griechische Philosoph, der ungefähr 300 v. Chr. lebte, trat ein für die Steigerung der Lebensfreude. Freundschaften pflegen, sich vom Alltagsstress befreien, sich in den Garten zurückziehen und Lustgewinn erzielen, das war sein Credo.“ Käthi, Werners Frau, ergänzte: „Und wahrscheinlich hat dieser Epikur den Rasen auch mit Pinzette und Nagelklips bearbeitet.“ „Sicher“, meinte Werner, „aber er hat kein Goldvreneli ausgesetzt für jene, die ein über einen Zentimeter hohes Jät im Rasen finden, wie ich das tue.“ „Ich würde ja bestimmt eines finden“, meinte Brigitta, „helfe dir aber sparen. Tausche dein Goldvreneli lieber gegen eine neue Fahne. Was da im Wind flattert, ist einem Patrioten, wie du ihn darstellst, absolut unwürdig.“ „Ok, Brigitta, ich stehe dazu, Patriot zu sein. Meine Liebe zur Heimat, mein Stolz auf den Sonderfall Schweiz und unsere Kompromisskultur haben gar nichts mit dem Zustand meiner Schweizer Fahne zu tun. Aber wenn wir schon davon sprechen, habe ich eine Idee: „Ich schenke dir die Fahne und dazu eine lehrreiche interdisziplinäre Schulstunde. Komm mit, wir ziehen die Fahne ein. Steh mal nahe zur Stange – gut, siehst traumhaft aus, eine Stangennummer würde dir super gut stehen.“ „Frechdachs“, erwiderte Brigitta: „Bring das mit der Schulstunde auf den Punkt.“
***
In nur ganz wenige, aber umso gespanntere Gesichter blickte Werner Müller, als er zum Frühlings-Workshop begrüßte. Für einmal kam man sich im Säli des Restaurants Post nicht näher. Werner war enttäuscht, was ihn aber nicht hinderte, sehr engagiert seine Rede zum „Wandel und wo wir heute stehen“ zu halten:
„Die Dame, meine Herren, beziehungsweise liebe Parteifreunde. Aus eurem Geschäftsleben kennt ihr den technologischen Wandel, z. B. die Tatsache, dass sich der Elektronikanteil in Maschinen permanent erhöht. Der Maschinenbau wird zum Systembau. Maschinen und Funktionen werden verkettet, durch Informatik, Transportsysteme, Roboterisierung. PC’ haben alle Arbeitsplätze erobert, CAD-Installationen haben die Reißbretter ersetzt. Auch der ökonomische Wandel ist manifest. Traditionelle Märkte wie Europa verlieren an Gewicht. Schwellenländer werden für die Exportindustrie immer bedeutungsvoller. Die Fertigungstiefe nimmt ab, der Einkauf internationalisiert sich. Dank NC-Technik und moderner Kommunikationsmittel kann überall auf der Welt bezüglich Produkten und Dienstleistungen Qualität angeboten werden. Das nennt man Globalisierung. In diesem Zusammenhang sind auch die Unternehmenszusammenschlüsse über die Grenzen hinweg zu sehen. Der Kampf um weltweite Marktanteile ist entbrannt und wird sich noch intensivieren.
Interessanterweise wandelt sich auch der Mensch. Im Gegensatz zum technischen und ökonomischen Wandel ist aber der soziale Wandel weniger augenfällig, aber sehr bedeutungsvoll für unser Verhalten. Man muss etwas weiter zurückschauen, um zu entdecken, wie sich das menschliche Wesen verändert. Guter Ausgangspunkt für unsere Betrachtungen ist der Zweite Weltkrieg, den wir nicht erlebt haben, weil erst knapp geboren, aber unsere Eltern. Der Krieg war nicht nur eine Auseinandersetzung um Macht, sondern es ging auch um die Form der gesellschaftlichen Lebensgestaltung. Die großen Demokratien zogen ins Feld, um ihre freiheitliche Ordnung vor der Bedrohung durch die totalitären Staaten zu verteidigen. Es bleibt der Wermutstropfen, dass der Sieg nur im Bündnis mit der Sowjetunion erreicht wurde, deren Totalitarismus aber, zumindest äußerlich, am zerfallen ist.
Unmittelbar nach Kriegsende setzte aber eine ungeheuerliche Entwicklung ein, welche auf jeden Fall die Älteren unter uns, du, Sandra, nicht, miterlebt haben. Zwei Stoßrichtungen lassen sich segmentieren.
Die erste dauerte bis ungefähr 1965. Es war die Ausgestaltung der spätkapitalistischen Wohlstandsgesellschaft. Die zweite, ab 1965 bis heute, ist die Entstehung der kritischen Gesellschaft. Die rasch eingetretene wirtschaftliche Entfaltung nach dem Zweiten Weltkrieg schaffte Gefühle der Zuversicht. Das reale, nicht nur das nominelle Bruttosozialprodukt, hatte sich ab Kriegsausbruch vervielfacht.
Das Wirtschaftswachstum macht den Mitarbeiter selbstbewusst. Er wird zum umworbenen Knappheitsfaktor. Nicht nur Lohn und Sozialleistungen müssen stimmen, er strebt auch nach Selbstständigkeit und interessanten Aufgaben. Die Gesellschaft ist aber insgesamt sehr leistungsorientiert, und der soziale Status einer Person ist von der beruflichen Stellung geprägt.“
Sandra hob die Hand und meinte: „Das ist heute noch so oder noch viel schlimmer. Ich werde über meinen Mann, der zufälligerweise Vizedirektor ist, definiert. Dass ich den Haushalt schmeiße, ihm den Rücken freihalte, die Buben erziehe, zählt nicht.“
Werner Müller in Fahrt, ließ sich nicht gerne unterbrechen, das Referat musste ein Guss sein. Etwas gereizt wies er darauf hin, dass später noch genügend Zeit für Diskussionen sei, er wolle fortfahren, wegen der Gesamtsicht der Dinge.
„Der hohe Wohlstand führt zu einer Ausebnung der Lebenshaltung, Auslandsreisen sind nicht nur einer elitären Schicht vorbehalten. Socken flickt niemand mehr. Die Pensionierten verstopfen die Flughäfen. Der größere Wohlstand führt aber auch dazu, dass die höheren Bildungsgänge von einem erheblich größeren Teil der Bevölkerung durchlaufen werden. Die Nachkriegsgesellschaft entwickelt sich zur Bildungsgesellschaft. Sie entwickelt sich aber auch zur pluralistischen Gesellschaft. Die soziale Willensbildung wird von einer Vielzahl von Trägern bestimmt, nicht nur vom Pfarrer und Lehrer. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verschmelzen zusehends, auch das Militär trägt wesentlich dazu bei. Der insbesondere von den Linken verunglimpfte Filz ist seit 30 Jahren gesellschaftlicher Tatbestand. Offenbar, Sandra, meine Kollegen, schwingt jedes Pendel einmal zurück, ab den 60er-Jahren rasant. Die kritische Gesellschaft entsteht. Die Jugend, die Intelligenzia, stellt die Echtheitsfrage nach der Lebensqualität und beeinflusst durch die Massenmedien breite Bevölkerungsschichten. Der Stellenwert der Arbeit, die Leistungserbringung, Autorität, wird infrage gestellt. Post-Materialisten verlangen mehr Mitbestimmung, Sinnerfüllung, bessere zwischenmenschliche Beziehungen. Gesellschaftliche, religiöse, ethische und rechtliche Normen verlieren stark an Bedeutung. Der Mensch verliert an äußeren Richtwerten, innere müssen entstehen. Doch der Mensch, auf sich selbst zurückgeworfen, ist überfordert. Nahbeziehungen erfahren eine Lockerung, die Scheidungsraten steigen, dank der Pille ist man nicht mehr ganz so streng verheiratet. (Werner blickte Sandra herausfordernd in die Augen, danach in den tiefen Ausschnitt, der wohlgeformte Brüste verriet.) Der Mensch verliert das Gefühl des Aufgehobenseins, der Zugehörigkeit.
Es ist total paradox, dass in Zeiten, wo der Sozialstaat ein Höchstmaß erreicht, größte Verunsicherung herrscht. Paradox scheint auch, dass die Kritik an der Wohlstandsgesellschaft keineswegs zu Verzichten an deren Vorteilen führt. Im Gegenteil: Die Leistungsgesellschaft wandelt sich zur hedonistischen Anspruchsgesellschaft. Die Bereitschaft zur Verschiebung von Bedürfnisbefriedigungen, zur Erbringung von Opfern und Ertragen von Unlust, nimmt ab.
Meine lieben Freunde, wir sind in der Gegenwart angelangt. Die Freizeit erhält auf Kosten der Arbeit vermehrt Bedeutung, auch auf bürgerlicher, auf unserer Seite. Durch Werte- und Normenverluste einerseits, Genussgesellschaft andererseits, findet eine Entfremdung zur Gesellschaftsordnung, zum Staat statt. Er ist gut, wenn er hilft, eigene Ziele zu erreichen, schlecht, wenn er im Wege steht.
Ich komme zum Schluss, Crescendo: Privatismus ist die Gesellschaftsform, die wir heute durchlaufen. Privatismus ist nur im Sozialstaat mit hohem Wohlstand und Sicherheiten denkbar. Wir können uns unseren privaten Vorlieben widmen, ohne dass wir befürchten müssen, dass uns dadurch gewichtige Nachteile erwachsen könnten. Die abwesenden Parteimitglieder tun das heute. Wir reagieren als Bürger nur dann noch, wenn wir von Behördenentscheiden direkt negativ betroffen sind. Das ist auch das Geheimnis der Stimmabstinenz: Wohlstand und Privatismus. Im Vordergrund steht nicht mehr das Gemeinwohlinteresse, sondern jenes einer Gruppe von Subjekten. Jetzt halte ich uns nur den Spiegel vor. Aber ich komme mir vor wie der Pfarrer in der Kirche. Jene, die es nötig hätten, sind auch nicht dabei.
Wir sind, meine Lieben, die Epikurer des 20. Jahrhunderts. 300 vor Christus empfahl der berühmte Philosoph Epikur, sich aus dem Gefängnis des Alltagsbetriebes und des Staatslebens zu befreien, das Dasein zu genießen, Freundschaften und den Garten zu pflegen. Die Natur wird heute zur Ästhetik, wir pflegen den Rasen mit der Pinzette, die Baumchirurgie wird zum wirtschaftlichen Wachstumszweig, Bauordnungen kümmern sich um die Dicke von Baumstämmen, während Begriffe wie Toleranz, Konsens, Solidarität dem Vokabular entfallen. Schnell zerfällt die Gesellschaft, wenn wir uns aus dem Wege gehen. Ich habe geschlossen und danke für eure Aufmerksamkeit.“
Der Applaus war anständig, aber nicht überschwänglich.
„Was hat das mit uns zu tun, werdet ihr euch fragen“, meinte Werner. Seiner Mentalität entsprechend wartete er nicht auf die Reaktion seiner Getreuen, sondern gab die Antwort gleich selbst: „Wir müssen den Privatismus durchbrechen, wenigstens bei unseren Mitgliedern, wenigstens für einige Male pro Jahr. Wenn wir dabei noch potenzielle Mitglieder erreichen, umso besser. Unsere FDP muss zu den Menschen gehen, Punkt eins. Punkt zwei: Wir müssen ihnen klar machen, dass gute Gemeindepolitik keine Selbstverständlichkeit ist, dass auch unsere Generation dazu einen Beitrag leisten muss. Mindestens gilt es, unseren Gemeinderat zu unterstützen. Und drittens: Wir müssen unsere Parteimitglieder durch ein Projekt aus der Lethargie reißen. Im Vorstand haben wir vorbesprochen, was das sein könnte.
***
Der Gedanke an den Verein „Freunde des Freilicht-Theaters Chalbach“ brachte ihn auf die Idee, Marianne anzurufen. Jetzt eine Verbündete zu wissen, würde ihm gut tun. Als Vorwand könnte er sie fragen, ob sie mit der Traktandenliste für die anstehende Vorstandssitzung einverstanden sei oder ob sie noch Ergänzungen hätte. Diese könnten natürlich auch wie üblich auch unter dem Traktandum Varia abgehandelt werden.
Werner freute sich riesig, als er Mariannes fröhliche Stimme schon nach dreimaligem Klingeln hörte. Als die vordergründig sachliche Frage der Traktandenliste besprochen war, fragte Werner: „Ist meine Mauer-Tragödie schon in eurem Dorf angekommen?“ „Was meinst du damit?“, fragte sie ahnungslos. „Das ist eine abendfüllende Geschichte.“ „Dann füllen wir doch mal einen Abend damit, ich bin diese Woche ohnehin alleine.“ „Super“, meinte Werner, „ich lade dich zum Abendessen ein.“ „Kommt nicht infrage, lass mich dich mal bekochen, für den Präsi tue ich das wirklich gerne.“ „Angenommen, aber ich bringe die Tranksame mit, vom Apéro bis zum Dessert.“ „Einverstanden, gerne“, sagte Marianne. „Hast du heute Abend Zeit, ich muss nämlich heute Nachmittag ohnehin noch einkaufen gehen.“ „Wunderbar, dann muss ich das nicht mehr, wann erwartest du mich?“ „Komm doch um 17 Uhr, dann haben wir so wunderbar Zeit füreinander.“ „Ich freue mich riesig, wir küssen uns später“, frohlockte Werner. Jetzt war der Tag nach dem misslichsten Morgen seines Lebens gerettet. Er flog gewissermaßen in den Keller, stellte eine Flasche Champagner kühl, zwei Flaschen Burgunder bereit sowie den besten Whisky, den er für ganz besondere Anlässe aufbewahrte.
In Anbetracht der Tatsache, dass er abends bei Marianne sicher zu viel essen würde, verköstigte er sich zum Mittagessen aus dem Kühlschrank. Etwas Knoblauchwurst, zwei Gurken, ein Ei und zwei Glas Rotwein mussten genügen und reichen für einen langen Mittagsschlaf. Am späteren Nachmittag überwand er den inneren Schweinehund und begab sich auf eine Runde mit den Walking-Stöcken. Nach einer heißen und abwechslungsweise kühlen Dusche fühlte er sich richtig fit.
Er kaufte im Blumengeschäft in Chalbach einen riesigen Blumenstrauß, den er zur im Korb liegenden Tranksame drapierte. Schlag 17 Uhr läutete er bei Marianne, die ihm im Minirock und markant längerer Schürze die Tür öffnete und ihn auf die Veranda bat. „Ich hab’s gleich, mach’s dir bequem“, sagte sie und eilte in die Küche. Sie kam zurück mit zwei Crevetten-Cocktails, Fleisch und Käsehäppchen, als Werner eben daran war, die Champagnerflasche zu öffnen. „Wow, was feiern wir denn heute?“, fragte Marianne, trat sehr nahe vor ihn hin und fasste ihn leicht an den Hüften. „Uns zwei“, frohlockte Werner und gab ihr einen kurzen Kuss auf die Lippen. „Wir sind doch das Dream-Team vom Freilicht-Theater.“ „Finde ich auch, ich hole uns nur noch die Champagner-Gläser.“ Marianne hatte die Küchenschürze abgelegt, als sie zurückkam. Erst jetzt fiel Werner ihre perfekt geformte Figur auf mit den für seinen Geschmack vielleicht etwas zu kleinen Brüsten. Sie genossen den Apéro und die Vorspeise, wobei Werner kaum zum Essen kam, denn er erzählte gleich seine Mauer-Geschichte. In Marianne hatte er eine aufmerksame Zuhörerin gefunden. Werner war froh, als er den mühsamen Teil hinter sich hatte. Marianne konnte ihm zwar, wie erwartet, auch nicht helfen, aber ihn trösten. „Nimm’s nicht zu schwer, ich bringe dich auf andere Gedanken“, sagte sie verständnisvoll und drückte sich an ihn. Nur schnell und ziemlich flüchtig, denn das Entrecote in der Pfanne duldete eigentlich keine Unaufmerksamkeit. Sie genossen den Hauptgang, wozu der von Werner mitgebrachte Burgunder ausgezeichnet passte und kamen bald vom leidigen Thema Mauer weg. Sie berieten, wie sie weitere Geldquellen fürs Freilicht-Theater generieren könnten, machten Späße über die anderen Vorstandsmitglieder, die Regisseurin sowie Schauspielerinnen und Schauspieler. Immer wieder prosteten sie sich zu: „Auf das Dream-Team.“
„Machen wir eine kleine Pause vor dem Dessert?“, fragte Marianne eher rhetorisch. „Sehr gerne“, sagte Werner, trat auf die Veranda, um eine Zigarette zu rauchen, während Marianne den Tisch abräumte und zur Verdauung zwei kleine Gläser Underberg auf den Beistelltisch neben den Aschenbecher stellte. Marianne legte eine CD ein, nahm Werner die Zigarette aus der Hand, nahm selbst einen tiefen Zug, drückte sie aus und flüsterte: „Schulterschluss-Musik ist das, komm lass uns tanzen.“ Sie führte ihn in die gute Stube, umfasste ihn am Hals und wiegte im Takt des romantisch wirkenden Slow-Foxes. Werner seinerseits umfasste ihre Hüfte, wartete einige Takte, ließ Erregung zu und küsste Marianne innig. Er drückte Marianne an sich, streichelte ihre Brust und fragte naiv: „Machen wir den Tanz noch fertig?“ Statt zu antworten, tanzte Marianne zur reichlich großen Polstergruppe, drückte Werner aufs Dreiersofa, setze sich rittlings auf ihn und entblößte ihren Oberkörper. Sie öffnete ihm die Hose und zog diese mit seiner Hilfe so weit hinunter, dass sie bequem sein erigiertes Glied massieren konnte. „Du brauchst keine Angst zu haben, ich nehme die Pille“, sagte sie, als sie sich auf seinen Schoss setzte und geschickt Werners Penis in sich hinein schob. Erst jetzt merkte Werner, dass Marianne ihren Slip vorgängig ausgezogen hatte.
„Hat gut getan, sich zwischenzeitlich etwas zu bewegen“, meinte Marianne, als sie das Dessert, ein wunderschönes Stück Schwarzwäldertorte, servierte. „Du hast dich bewegt, ich habe nur genossen“, erwiderte Werner. Schelmisch entgegnete Marianne: „Rollentausch nach dem Dessert, zum Whisky.“
Brigitta genoss ihre freien Nachmittage im Sommer gerne bei Müllers. Der wunderschön gepflegte Garten bot totale Privatsphäre, was ihr erlaubte, sich auch oben ohne zu sonnen. Für sie bedeutete das Lebensqualität, totale Freiheit. Ihr Glücksgefühl erreichte ein beinahe orgiastisches Ausmaß, wenn sie sich dazu einen Wodka Mojito gönnte. Mit viel Liebe rührte sie zwei Teelöffel Zucker in Limettensaft in einem eisgekühlten Glas, gab zwei Pfefferminzblätter dazu, etwas zerstoßenes Eis, einen Schluck Mineralwasser und doppelt so viel Beluga wie Limettensaft. Käthi konnte Brigittas Begeisterung für das „Wässerchen aus Kartoffeln“ nicht nachvollziehen. Bitter Lemon und ein Eiswürfel genügten ihr, war weniger aufwendig in der Zubereitung und enthielt vor allem wenig Alkohol, den sie beim Sonnenbaden schlecht ertragen konnte.
Es war ein Bild zum Verlieben: Brigitta auf der weißen Sonnenliege, versehen mit einem dicken blauen Polster, das Rückenteil hochgestellt, ihre prallen, braunen Brüste in der Sonne glänzend, die Brustwarzen keck hervortretend. Das postautogelbe Röhrchen, durch das sie den Wodka schlürfte, beinahe kitschig zu ihren roten Lippen und blendend weißen Zähnen. „He Masochist, wie lange stählst du deinen Waschbrettbauch noch?“, rief sie Werner zu. „Zwei Runden noch, du darfst aufsitzen.“ Brigitta, inzwischen aufgestanden, prüfte die Wassertemperatur, goss sich – statt zu Duschen – als symbolische Geste eine Handvoll Wasser über ihre Brüste und glitt ins Wasser. „Jetzt spielen wir Frosch“, meinte sie, krabbelte auf seinen Rücken und ließ sich durchs Bassin ziehen. „Bei den Fröschen ist aber das Männchen oben“, monierte Werner, tauchte ab und klammerte sich nun seinerseits auf ihrem Rücken fest. Er drückte sein mittlerweile leicht erigiertes Glied gegen ihre Pospalte, worauf Brigitta mit einem Arm nach hinten griff und mit der Hand in seiner Badehose landete. „Keine schlechte Reaktion für dein Alter, Papi“, flüsterte sie und schwamm davon. Versammelt auf den Liegestühlen liebten sie es, in Zeitschriften zu schmökern (was immer wieder zu gutem Gesprächsstoff führte) oder einfach den Garten zu betrachten, den Blick in die weite Landschaft zu genießen.
„Du bist für mich der Epikur des 21. Jahrhunderts“, sagte Brigitta zu Werner. „Was meinst du damit?“, fragte er. „Weißt du, dieser griechische Philosoph, der ungefähr 300 v. Chr. lebte, trat ein für die Steigerung der Lebensfreude. Freundschaften pflegen, sich vom Alltagsstress befreien, sich in den Garten zurückziehen und Lustgewinn erzielen, das war sein Credo.“ Käthi, Werners Frau, ergänzte: „Und wahrscheinlich hat dieser Epikur den Rasen auch mit Pinzette und Nagelklips bearbeitet.“ „Sicher“, meinte Werner, „aber er hat kein Goldvreneli ausgesetzt für jene, die ein über einen Zentimeter hohes Jät im Rasen finden, wie ich das tue.“ „Ich würde ja bestimmt eines finden“, meinte Brigitta, „helfe dir aber sparen. Tausche dein Goldvreneli lieber gegen eine neue Fahne. Was da im Wind flattert, ist einem Patrioten, wie du ihn darstellst, absolut unwürdig.“ „Ok, Brigitta, ich stehe dazu, Patriot zu sein. Meine Liebe zur Heimat, mein Stolz auf den Sonderfall Schweiz und unsere Kompromisskultur haben gar nichts mit dem Zustand meiner Schweizer Fahne zu tun. Aber wenn wir schon davon sprechen, habe ich eine Idee: „Ich schenke dir die Fahne und dazu eine lehrreiche interdisziplinäre Schulstunde. Komm mit, wir ziehen die Fahne ein. Steh mal nahe zur Stange – gut, siehst traumhaft aus, eine Stangennummer würde dir super gut stehen.“ „Frechdachs“, erwiderte Brigitta: „Bring das mit der Schulstunde auf den Punkt.“
***
In nur ganz wenige, aber umso gespanntere Gesichter blickte Werner Müller, als er zum Frühlings-Workshop begrüßte. Für einmal kam man sich im Säli des Restaurants Post nicht näher. Werner war enttäuscht, was ihn aber nicht hinderte, sehr engagiert seine Rede zum „Wandel und wo wir heute stehen“ zu halten:
„Die Dame, meine Herren, beziehungsweise liebe Parteifreunde. Aus eurem Geschäftsleben kennt ihr den technologischen Wandel, z. B. die Tatsache, dass sich der Elektronikanteil in Maschinen permanent erhöht. Der Maschinenbau wird zum Systembau. Maschinen und Funktionen werden verkettet, durch Informatik, Transportsysteme, Roboterisierung. PC’ haben alle Arbeitsplätze erobert, CAD-Installationen haben die Reißbretter ersetzt. Auch der ökonomische Wandel ist manifest. Traditionelle Märkte wie Europa verlieren an Gewicht. Schwellenländer werden für die Exportindustrie immer bedeutungsvoller. Die Fertigungstiefe nimmt ab, der Einkauf internationalisiert sich. Dank NC-Technik und moderner Kommunikationsmittel kann überall auf der Welt bezüglich Produkten und Dienstleistungen Qualität angeboten werden. Das nennt man Globalisierung. In diesem Zusammenhang sind auch die Unternehmenszusammenschlüsse über die Grenzen hinweg zu sehen. Der Kampf um weltweite Marktanteile ist entbrannt und wird sich noch intensivieren.
Interessanterweise wandelt sich auch der Mensch. Im Gegensatz zum technischen und ökonomischen Wandel ist aber der soziale Wandel weniger augenfällig, aber sehr bedeutungsvoll für unser Verhalten. Man muss etwas weiter zurückschauen, um zu entdecken, wie sich das menschliche Wesen verändert. Guter Ausgangspunkt für unsere Betrachtungen ist der Zweite Weltkrieg, den wir nicht erlebt haben, weil erst knapp geboren, aber unsere Eltern. Der Krieg war nicht nur eine Auseinandersetzung um Macht, sondern es ging auch um die Form der gesellschaftlichen Lebensgestaltung. Die großen Demokratien zogen ins Feld, um ihre freiheitliche Ordnung vor der Bedrohung durch die totalitären Staaten zu verteidigen. Es bleibt der Wermutstropfen, dass der Sieg nur im Bündnis mit der Sowjetunion erreicht wurde, deren Totalitarismus aber, zumindest äußerlich, am zerfallen ist.
Unmittelbar nach Kriegsende setzte aber eine ungeheuerliche Entwicklung ein, welche auf jeden Fall die Älteren unter uns, du, Sandra, nicht, miterlebt haben. Zwei Stoßrichtungen lassen sich segmentieren.
Die erste dauerte bis ungefähr 1965. Es war die Ausgestaltung der spätkapitalistischen Wohlstandsgesellschaft. Die zweite, ab 1965 bis heute, ist die Entstehung der kritischen Gesellschaft. Die rasch eingetretene wirtschaftliche Entfaltung nach dem Zweiten Weltkrieg schaffte Gefühle der Zuversicht. Das reale, nicht nur das nominelle Bruttosozialprodukt, hatte sich ab Kriegsausbruch vervielfacht.
Das Wirtschaftswachstum macht den Mitarbeiter selbstbewusst. Er wird zum umworbenen Knappheitsfaktor. Nicht nur Lohn und Sozialleistungen müssen stimmen, er strebt auch nach Selbstständigkeit und interessanten Aufgaben. Die Gesellschaft ist aber insgesamt sehr leistungsorientiert, und der soziale Status einer Person ist von der beruflichen Stellung geprägt.“
Sandra hob die Hand und meinte: „Das ist heute noch so oder noch viel schlimmer. Ich werde über meinen Mann, der zufälligerweise Vizedirektor ist, definiert. Dass ich den Haushalt schmeiße, ihm den Rücken freihalte, die Buben erziehe, zählt nicht.“
Werner Müller in Fahrt, ließ sich nicht gerne unterbrechen, das Referat musste ein Guss sein. Etwas gereizt wies er darauf hin, dass später noch genügend Zeit für Diskussionen sei, er wolle fortfahren, wegen der Gesamtsicht der Dinge.
„Der hohe Wohlstand führt zu einer Ausebnung der Lebenshaltung, Auslandsreisen sind nicht nur einer elitären Schicht vorbehalten. Socken flickt niemand mehr. Die Pensionierten verstopfen die Flughäfen. Der größere Wohlstand führt aber auch dazu, dass die höheren Bildungsgänge von einem erheblich größeren Teil der Bevölkerung durchlaufen werden. Die Nachkriegsgesellschaft entwickelt sich zur Bildungsgesellschaft. Sie entwickelt sich aber auch zur pluralistischen Gesellschaft. Die soziale Willensbildung wird von einer Vielzahl von Trägern bestimmt, nicht nur vom Pfarrer und Lehrer. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verschmelzen zusehends, auch das Militär trägt wesentlich dazu bei. Der insbesondere von den Linken verunglimpfte Filz ist seit 30 Jahren gesellschaftlicher Tatbestand. Offenbar, Sandra, meine Kollegen, schwingt jedes Pendel einmal zurück, ab den 60er-Jahren rasant. Die kritische Gesellschaft entsteht. Die Jugend, die Intelligenzia, stellt die Echtheitsfrage nach der Lebensqualität und beeinflusst durch die Massenmedien breite Bevölkerungsschichten. Der Stellenwert der Arbeit, die Leistungserbringung, Autorität, wird infrage gestellt. Post-Materialisten verlangen mehr Mitbestimmung, Sinnerfüllung, bessere zwischenmenschliche Beziehungen. Gesellschaftliche, religiöse, ethische und rechtliche Normen verlieren stark an Bedeutung. Der Mensch verliert an äußeren Richtwerten, innere müssen entstehen. Doch der Mensch, auf sich selbst zurückgeworfen, ist überfordert. Nahbeziehungen erfahren eine Lockerung, die Scheidungsraten steigen, dank der Pille ist man nicht mehr ganz so streng verheiratet. (Werner blickte Sandra herausfordernd in die Augen, danach in den tiefen Ausschnitt, der wohlgeformte Brüste verriet.) Der Mensch verliert das Gefühl des Aufgehobenseins, der Zugehörigkeit.
Es ist total paradox, dass in Zeiten, wo der Sozialstaat ein Höchstmaß erreicht, größte Verunsicherung herrscht. Paradox scheint auch, dass die Kritik an der Wohlstandsgesellschaft keineswegs zu Verzichten an deren Vorteilen führt. Im Gegenteil: Die Leistungsgesellschaft wandelt sich zur hedonistischen Anspruchsgesellschaft. Die Bereitschaft zur Verschiebung von Bedürfnisbefriedigungen, zur Erbringung von Opfern und Ertragen von Unlust, nimmt ab.
Meine lieben Freunde, wir sind in der Gegenwart angelangt. Die Freizeit erhält auf Kosten der Arbeit vermehrt Bedeutung, auch auf bürgerlicher, auf unserer Seite. Durch Werte- und Normenverluste einerseits, Genussgesellschaft andererseits, findet eine Entfremdung zur Gesellschaftsordnung, zum Staat statt. Er ist gut, wenn er hilft, eigene Ziele zu erreichen, schlecht, wenn er im Wege steht.
Ich komme zum Schluss, Crescendo: Privatismus ist die Gesellschaftsform, die wir heute durchlaufen. Privatismus ist nur im Sozialstaat mit hohem Wohlstand und Sicherheiten denkbar. Wir können uns unseren privaten Vorlieben widmen, ohne dass wir befürchten müssen, dass uns dadurch gewichtige Nachteile erwachsen könnten. Die abwesenden Parteimitglieder tun das heute. Wir reagieren als Bürger nur dann noch, wenn wir von Behördenentscheiden direkt negativ betroffen sind. Das ist auch das Geheimnis der Stimmabstinenz: Wohlstand und Privatismus. Im Vordergrund steht nicht mehr das Gemeinwohlinteresse, sondern jenes einer Gruppe von Subjekten. Jetzt halte ich uns nur den Spiegel vor. Aber ich komme mir vor wie der Pfarrer in der Kirche. Jene, die es nötig hätten, sind auch nicht dabei.
Wir sind, meine Lieben, die Epikurer des 20. Jahrhunderts. 300 vor Christus empfahl der berühmte Philosoph Epikur, sich aus dem Gefängnis des Alltagsbetriebes und des Staatslebens zu befreien, das Dasein zu genießen, Freundschaften und den Garten zu pflegen. Die Natur wird heute zur Ästhetik, wir pflegen den Rasen mit der Pinzette, die Baumchirurgie wird zum wirtschaftlichen Wachstumszweig, Bauordnungen kümmern sich um die Dicke von Baumstämmen, während Begriffe wie Toleranz, Konsens, Solidarität dem Vokabular entfallen. Schnell zerfällt die Gesellschaft, wenn wir uns aus dem Wege gehen. Ich habe geschlossen und danke für eure Aufmerksamkeit.“
Der Applaus war anständig, aber nicht überschwänglich.
„Was hat das mit uns zu tun, werdet ihr euch fragen“, meinte Werner. Seiner Mentalität entsprechend wartete er nicht auf die Reaktion seiner Getreuen, sondern gab die Antwort gleich selbst: „Wir müssen den Privatismus durchbrechen, wenigstens bei unseren Mitgliedern, wenigstens für einige Male pro Jahr. Wenn wir dabei noch potenzielle Mitglieder erreichen, umso besser. Unsere FDP muss zu den Menschen gehen, Punkt eins. Punkt zwei: Wir müssen ihnen klar machen, dass gute Gemeindepolitik keine Selbstverständlichkeit ist, dass auch unsere Generation dazu einen Beitrag leisten muss. Mindestens gilt es, unseren Gemeinderat zu unterstützen. Und drittens: Wir müssen unsere Parteimitglieder durch ein Projekt aus der Lethargie reißen. Im Vorstand haben wir vorbesprochen, was das sein könnte.
***
Der Gedanke an den Verein „Freunde des Freilicht-Theaters Chalbach“ brachte ihn auf die Idee, Marianne anzurufen. Jetzt eine Verbündete zu wissen, würde ihm gut tun. Als Vorwand könnte er sie fragen, ob sie mit der Traktandenliste für die anstehende Vorstandssitzung einverstanden sei oder ob sie noch Ergänzungen hätte. Diese könnten natürlich auch wie üblich auch unter dem Traktandum Varia abgehandelt werden.
Werner freute sich riesig, als er Mariannes fröhliche Stimme schon nach dreimaligem Klingeln hörte. Als die vordergründig sachliche Frage der Traktandenliste besprochen war, fragte Werner: „Ist meine Mauer-Tragödie schon in eurem Dorf angekommen?“ „Was meinst du damit?“, fragte sie ahnungslos. „Das ist eine abendfüllende Geschichte.“ „Dann füllen wir doch mal einen Abend damit, ich bin diese Woche ohnehin alleine.“ „Super“, meinte Werner, „ich lade dich zum Abendessen ein.“ „Kommt nicht infrage, lass mich dich mal bekochen, für den Präsi tue ich das wirklich gerne.“ „Angenommen, aber ich bringe die Tranksame mit, vom Apéro bis zum Dessert.“ „Einverstanden, gerne“, sagte Marianne. „Hast du heute Abend Zeit, ich muss nämlich heute Nachmittag ohnehin noch einkaufen gehen.“ „Wunderbar, dann muss ich das nicht mehr, wann erwartest du mich?“ „Komm doch um 17 Uhr, dann haben wir so wunderbar Zeit füreinander.“ „Ich freue mich riesig, wir küssen uns später“, frohlockte Werner. Jetzt war der Tag nach dem misslichsten Morgen seines Lebens gerettet. Er flog gewissermaßen in den Keller, stellte eine Flasche Champagner kühl, zwei Flaschen Burgunder bereit sowie den besten Whisky, den er für ganz besondere Anlässe aufbewahrte.
In Anbetracht der Tatsache, dass er abends bei Marianne sicher zu viel essen würde, verköstigte er sich zum Mittagessen aus dem Kühlschrank. Etwas Knoblauchwurst, zwei Gurken, ein Ei und zwei Glas Rotwein mussten genügen und reichen für einen langen Mittagsschlaf. Am späteren Nachmittag überwand er den inneren Schweinehund und begab sich auf eine Runde mit den Walking-Stöcken. Nach einer heißen und abwechslungsweise kühlen Dusche fühlte er sich richtig fit.
Er kaufte im Blumengeschäft in Chalbach einen riesigen Blumenstrauß, den er zur im Korb liegenden Tranksame drapierte. Schlag 17 Uhr läutete er bei Marianne, die ihm im Minirock und markant längerer Schürze die Tür öffnete und ihn auf die Veranda bat. „Ich hab’s gleich, mach’s dir bequem“, sagte sie und eilte in die Küche. Sie kam zurück mit zwei Crevetten-Cocktails, Fleisch und Käsehäppchen, als Werner eben daran war, die Champagnerflasche zu öffnen. „Wow, was feiern wir denn heute?“, fragte Marianne, trat sehr nahe vor ihn hin und fasste ihn leicht an den Hüften. „Uns zwei“, frohlockte Werner und gab ihr einen kurzen Kuss auf die Lippen. „Wir sind doch das Dream-Team vom Freilicht-Theater.“ „Finde ich auch, ich hole uns nur noch die Champagner-Gläser.“ Marianne hatte die Küchenschürze abgelegt, als sie zurückkam. Erst jetzt fiel Werner ihre perfekt geformte Figur auf mit den für seinen Geschmack vielleicht etwas zu kleinen Brüsten. Sie genossen den Apéro und die Vorspeise, wobei Werner kaum zum Essen kam, denn er erzählte gleich seine Mauer-Geschichte. In Marianne hatte er eine aufmerksame Zuhörerin gefunden. Werner war froh, als er den mühsamen Teil hinter sich hatte. Marianne konnte ihm zwar, wie erwartet, auch nicht helfen, aber ihn trösten. „Nimm’s nicht zu schwer, ich bringe dich auf andere Gedanken“, sagte sie verständnisvoll und drückte sich an ihn. Nur schnell und ziemlich flüchtig, denn das Entrecote in der Pfanne duldete eigentlich keine Unaufmerksamkeit. Sie genossen den Hauptgang, wozu der von Werner mitgebrachte Burgunder ausgezeichnet passte und kamen bald vom leidigen Thema Mauer weg. Sie berieten, wie sie weitere Geldquellen fürs Freilicht-Theater generieren könnten, machten Späße über die anderen Vorstandsmitglieder, die Regisseurin sowie Schauspielerinnen und Schauspieler. Immer wieder prosteten sie sich zu: „Auf das Dream-Team.“
„Machen wir eine kleine Pause vor dem Dessert?“, fragte Marianne eher rhetorisch. „Sehr gerne“, sagte Werner, trat auf die Veranda, um eine Zigarette zu rauchen, während Marianne den Tisch abräumte und zur Verdauung zwei kleine Gläser Underberg auf den Beistelltisch neben den Aschenbecher stellte. Marianne legte eine CD ein, nahm Werner die Zigarette aus der Hand, nahm selbst einen tiefen Zug, drückte sie aus und flüsterte: „Schulterschluss-Musik ist das, komm lass uns tanzen.“ Sie führte ihn in die gute Stube, umfasste ihn am Hals und wiegte im Takt des romantisch wirkenden Slow-Foxes. Werner seinerseits umfasste ihre Hüfte, wartete einige Takte, ließ Erregung zu und küsste Marianne innig. Er drückte Marianne an sich, streichelte ihre Brust und fragte naiv: „Machen wir den Tanz noch fertig?“ Statt zu antworten, tanzte Marianne zur reichlich großen Polstergruppe, drückte Werner aufs Dreiersofa, setze sich rittlings auf ihn und entblößte ihren Oberkörper. Sie öffnete ihm die Hose und zog diese mit seiner Hilfe so weit hinunter, dass sie bequem sein erigiertes Glied massieren konnte. „Du brauchst keine Angst zu haben, ich nehme die Pille“, sagte sie, als sie sich auf seinen Schoss setzte und geschickt Werners Penis in sich hinein schob. Erst jetzt merkte Werner, dass Marianne ihren Slip vorgängig ausgezogen hatte.
„Hat gut getan, sich zwischenzeitlich etwas zu bewegen“, meinte Marianne, als sie das Dessert, ein wunderschönes Stück Schwarzwäldertorte, servierte. „Du hast dich bewegt, ich habe nur genossen“, erwiderte Werner. Schelmisch entgegnete Marianne: „Rollentausch nach dem Dessert, zum Whisky.“