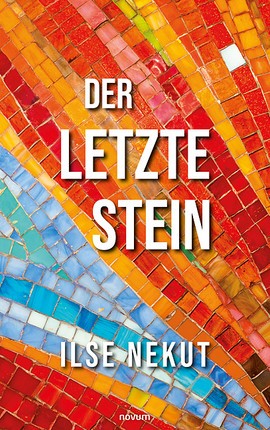Alina, die andere Frau
Ilse Nekut
EUR 16,90
EUR 13,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 146
ISBN: 978-3-99146-019-0
Erscheinungsdatum: 26.04.2023
Klara, eine gut situierte Buchhändlerin – Alina, eine Krankenpflegerin, die vor dem Krieg geflüchtet ist. Zwei Frauen in einer Kleinstadt. Zwei Leben, die unterschiedlicher nicht sein können. Scheinbare Berührungspunkte führen zu einer überraschenden Wendung …
Der erste Satz kann nicht geschrieben werden,
bevor der letzte Satz geschrieben ist.
(Joyce Carol Oates)
1
Durch knöchelhohes Laub stapfte sie. Es war kalt, der Atem in der Sonne sichtbar. Goldene Blätter in den Bäumen, gleich würden sie fallen. Blattgold am Boden. Fast sank sie ein im Laubmeer.
Es war wie das Wattenmeer, mit hartem Sand unter den Füßen. Erinnerung an Wind im Norden, vor vielen Jahren.
Die leichten, toten Blätter des Sommerendes schwebten schaukelnd zu Boden, zerbrechliche Gebilde. Sie trat darauf, vorsichtig zwar, aber sie trat darauf. Kein einziges der Blätter wurde von Klara dabei verletzt oder getötet. Das Laub war unverletzbar. War schon tot.
Der Frost knisterte wie Seidenpapier unter ihren Fußsohlen. Spiegelung des heute besonders großen sonnenblauen Himmels in diesem raschelnden, goldroten Meer, aber nur, wenn sie der Sonne entgegenging, immer entgegenging.
Blätter, die derart strahlten, das hatte sie zuvor noch nie gesehen. Sie würde nächste Nacht nochmals hierherkommen und sehen, ob diese Blätter auch im Dunkeln leuchteten. Wie fluoreszierende zarte Tierchen am Grund des Meeres, weit außerhalb des Watts.
Was wäre, wenn sie einsinken würde in diesem Blättermeer? Wie im Watt bei Flut. Wenn es keinen Halt mehr gäbe unter den Füßen. Trotzdem. Angst vor dem Versinken hatte sie nicht, eher die Sehnsucht danach.
Ein paar Schritte weiter fielen die Blätter plötzlich nicht aus den Bäumen nach unten. Nein. Es war umgekehrt. Das goldene, noch nicht ganz vertrocknete Laub erhob sich im leichten Wind vom Boden, tanzte schwerelos aufwärts, tanzte durch die kalte Luft hinauf in die Äste zweier Birken, blieb an den weißen Zweigen hängen, leuchtete stärker, je höher es sich im Geäst ansiedelte. Die Stämme der Birken waren kaum zu sehen, nur die Blätter. Blätterwolke statt Blättermeer.
Zwischen den Birken hing Jesus am Kreuz. Jesus, umrahmt von den dünnädrigen, aufwärts fliegenden Blättern, die der Kreuzestod nicht kümmerte.
Klara glaubte nicht an Gott, doch die Gestalt seines Sohnes vor ihr, der Gekreuzigte und das Blattgold um ihn herum, das war eindrucksvoll. Zugegeben.
Neben Jesus lag still ein verwilderter Garten. Ein unbeschnittener Apfelbaum nahe am Zaun. Die überreifen, verfaulten Äpfel waren ins Gras gefallen, noch immer rotbäckig, aber matschig weich mit braunen Flecken, angeschimmelt. Sicher wohnten Würmer in diesen Äpfeln, hell, farblos, dünner als Maden.
Was, wenn diese Würmer zu Jesus krochen? Auf dem Kreuzbalken hinauf, zuerst zu den Füßen, dann in seinen Körper. Ein bisschen Leben in ihm, dem toten Nazarener. Wurmstichiges Leben.
Da mahnte Klaras Armbanduhr. Kaltbeschlagene Uhr, die angehaucht werden musste, um die Zeit anzuzeigen. Klara wollte zurück, zurück ins Leben ohne Goldlaub und ohne Würmer.
Ins warme Leben.
In ihren Turm.
Fast hätte sie Jesus zum Abschied gegrüßt, aber wie grüßt man einen Gekreuzigten? Einen an hohes Holz Genagelten?
Auf ihrem Weg nach Hause machte sie sich Sorgen um diesen Jesus von Nazareth. Er hatte ja wirklich gelebt, daran zumindest glaubte sie.
Ob die gelbbraunen Birkenblätter, die Jesus an diesem Herbsttag umrahmten, ihn berührten, wenn sie zu Boden fielen? Oder ob sie wegblieben von ihm, weg von seinem Leib? Es könnte ja sein, dass eine verletzbare Stelle an seinem Körper entstand, wenn sich ein Blatt an seine Schulter heftete. An die Schulter wie bei dieser Sage um Siegfried. Siegfried im Blut des Drachen badend, ein Lindenblatt auf der Schulter, an dieser Stelle verletzbar. Und hier der nackte Jesus, fast überall unverwundbar. Nur an dieser einen Stelle, an die sich das Blatt heftete, würde man ihn töten können.
Aber Jesus war ja längst tot, also ohnehin nicht mehr verwundbar. Man musste sich keine Sorgen machen, auch Klara nicht. Menschen haben ihn zu Tode gehetzt. Ein Speer von Menschen, ein Kreuz, von Menschen gezimmert. Und jetzt hing er als schmerzensreiche Holzfigur am Rand von Klaras Weg.
Warum hatten so viele Menschen einen gehetzten, zu Tode gekreuzigten Erlöser ausgesucht, um ihn in ihre Zimmer, ihre Schulklassen zu hängen. Ein Verbrechen, fortwährend sichtbar. Warum verehrten sie nicht einen lächelnden, genießenden Gottessohn? Einen Gottessohn, der in Freude strahlt. Warum diese Marter?
Nein, so mochte Klara ihn nicht, so leidend. Sollte er doch weiter hier hängen, Erlösung hin oder her. Es war ihr egal.
Heimwärts, mit Haube und kaltsteifen Händen in den Taschen, sichtbare Atemluft vor der Nase, ein kaltes Prickeln auf der Stirn, dort, wo die Haube endete.
Anderntags packte sie ihre reichlich vorhandenen Acrylfarben zusammen, einen Kübel mit Wasser, einen dicken Pinsel. Sie ging den Weg zum Gekreuzigten hinauf, stieg auf die wackelige Bank, die unter Jesu Füßen stand, und lockerte die ohnehin nur mehr leicht verankerten, verrosteten Schrauben, die durch die Hände des Gottessohns gebohrt worden waren, von wem auch immer. Vorsichtig hob sie die hölzerne Figur vom Kreuz. Jesus war leichter als gedacht. Weg vom Kreuz hob sie ihn. Bettete ihn ins Gras. In die Sonne.
Und dann malte sie. Sie bemalte Jesus mit grünen, grellroten, in pink schillernden und gelben Farbinseln, umhüllt von tiefem Blau. Ein türkiser Ozean breitete sich auf Jesu Brust aus. Klara band ihm ein Tuch mit weißen Sternen auf rotem Grund um seine Stirn. Wie in Woodstock damals, wo dieser Jesus sicher anwesend war. Unsichtbar zwar, aber anwesend.
Da lag er nun, geschmückt mit bunten Linien und Flecken und mit einem Stirnband. Klara hob ihn wieder hinauf auf seinen angestammten Platz, betrachtete ihr farbiges Werk.
Sicher war Jesus Christus jetzt glücklicher auf seinem Kreuz.
Sicher.
Niemand hatte Klara gesehen.
Ihre Finger waren voller Farben, wie das Lendentuch des Nazareners. Sie lächelte ihn an. So einem Gottessohn konnte sie zulächeln. So einem schon.
2
Alina war anders als ihre Kolleginnen im Krankenhaus. Sie klagte nie über die Arbeit, fluchte aber mitunter leise. Fluchte, wenn der alte Herr im Zimmer 6 glaubte, ihr an den Hintern greifen zu dürfen. Fluchte, wenn das junge Ding im Zimmer 7 die Pflegerinnen ständig um irgendetwas bat. Fluchte, aber meinte es nicht so. Sie reagierte dabei die Belastung ab, unter der sie alle litten. Alina am wenigsten. Vielleicht weil sie fluchte.
Sie war vor 10 Jahren aus ihrer Heimat hierhergekommen. Hatte sofort Arbeit gefunden. Gute Krankenpflegerinnen waren gesucht. Wenn man sie fragte, woher sie und ihre Tochter kämen, sagte sie nur:
„Aus dem Land unter den Bomben“
Sie konnte den Namen ihres Heimatlandes nicht aussprechen, ohne dass ihre Stimme zitterte. Also Bombenland.
Nach der Trennung von Sadec hatte sie den Mädchennamen ihrer deutschen Mutter wieder angenommen: Schuhman. Ihr Vater hatte die Mutter zu einem durchsichtigen, willenlosen Wesen gemacht, darum wählte sie Mutters Mädchennamen. Genau darum. Vielleicht wollte sie die Mutter im Nachhinein retten, wenigstens ihren Namen dingfest machen. In Alinas Heimat hieß niemand Schuhman. Da hieß man Selinki, Worslow, Charinko. Jetzt aber hieß Alina Schuhman. Ihr gewalttätiger Vater war vor Jahren ums Leben gekommen. Unfalltod.
Schuhman – ein schöner Name. So rund und geschmeidig, fand Alina.
3
Bei einem gemeinsamen Spaziergang in der Mittagspause entdeckten Alina und ihr Freund Ralph einen bemalten Gottessohn. Der hölzerne Jesus, der da schon lange ruhig neben dem Weg hing, war mit bunten Farben beschmiert worden, von wem auch immer. Alina war entsetzt von so viel Respektlosigkeit. Sie empfand es als Vandalismus, den Gekreuzigten so herzurichten. Gut, sie war nicht gläubig, aber so eine Blasphemie wollte sie keinesfalls zulassen. Ralph fand zwar, dass sie sich raushalten sollten aus dieser Sache, aber Alina bestand darauf, Jesus wiederherzustellen.
Sie pflückten ihn ab von seinem morschen Kreuz, putzten ihn mit großen rauen Blättern, die neben dem Weg wuchsen, hängten ihn wieder an seinen Platz. Er war nun wieder Braun in Braun zu sehen. Nicht bunt.
Zu ihrer Arbeit im Spital kamen sie nach der Mittagspause gerade noch zurecht.
4
Wenn Alina ins Krankenhaus zur Arbeit fuhr, wählte sie immer den gleichen Weg. Rasch vorbei am Kindergarten, wo sie manchmal zwei Mädchen, die am Zaun winkten, kurz zuhupte. Es klang wie „Grüß euch, ihr beiden“. Sie fuhr vorbei an der Feuerwehr, am Röntgeninstitut, an der „Lebenshilfe“. Jedes Mal erinnerte sie sich an eine Freundin, deren Sohn in solch einer Werkstatt lebte. Die Operation, der sich der Bub als Baby hatte unterziehen müssen, war ihm zum Verhängnis geworden. Etwas zu viel Narkose, und schon war das Kind nicht wie andere Kinder. Es sah die Welt anders als andere Leute, vielleicht sogar bunter, vielfältiger. Es sah die Menschen anders an, betrachtete sie aus anderen Augen. Wie genau, das wusste niemand so recht. Das Wichtigste war, dass er selbst nicht sah, dass er anders war. Er war glücklich in seiner Welt.
Der Bub, inzwischen ein Mann, lebte schon lange so.
Alina war meist in Eile. Sie wusste, dass sie pünktlich zu ihrer Schicht erscheinen musste. Man brauchte im Krankenhaus jeden Pfleger, jede Pflegerin. Es waren schlechte Zeiten für Spitäler. Trotz der Belastung mochte Alina ihren Beruf, auch wenn er sehr anstrengend war. Manchmal wollte sie sich einfach zu einem Patienten ins Bett legen, entspannen, schlafen. Und manchmal wollte sie, wie die anderen auch, höheren Lohn für ihre Arbeit. Trotzdem. Alina war zufrieden.
Aus jenem Land, in dem jetzt schon lange Krieg war, war sie geflohen. Vor zehn Jahren. Geflohen mit ihrer Tochter Dina. Dina war gerade sieben geworden damals. Ihr schlechtes Gewissen wischte Alina weg. Das Gewissen, das ihr vorwarf, sie habe überlebt und andere nicht. Nein. Es war richtig gewesen zu fliehen. Die Tochter war zwar anfangs betrübt gewesen, hier in diesem fremden Land ohne ihre Freundinnen. Aber bald hatte sie neue gefunden, hatte Fuß gefasst im Friedensland. Und hier in Karberg, hier brauchte man Alina.
Von ihrem Mann Sadec war sie schon sehr lange getrennt. Er hatte im Bombenland bleiben müssen. Generalmobilmachung.
„Er ist im Krieg geblieben“, antworteten Alina oder ihre Tochter, wenn sie gefragt wurden. Das hieß in Wirklichkeit Tod im Häuserkampf, im Schützengraben, aus dem Hinterhalt. Die Worte „Er ist im Krieg geblieben“ verschwiegen das Grauen und das Sterben. Klangen glatt. Glatt wie Eis, unter dem es dunkel war und kalt.
Es war einer Freundin aus ihrer Heimat zu verdanken, dass Alina die deutsche Sprache heute perfekt beherrschte. Die Freundin war schon lange hier in Karberg, und sie hatte Alina gedrängt und gestoßen. Gedrängt, in einen Sprachkurs zu gehen. Und Alina war begabt. Es gelang. Sie sprach fast ohne Akzent. Auch ihrer Tochter Dina war ihre Herkunft kaum anzumerken.
Alina war im Spital angelangt. Vorbei der Kindergarten, das Röntgeninstitut, die „Lebenshilfe“. Schnell in ihre weiße Arbeitskleidung und rasch hinauf in den 1. Stock, wo ihre Krankenstation auf sie wartete.
5
Klara wohnte in einem Turm, einem runden Turm. Freunde hatten die renovierungsbedürftige Burg, zu der dieser Turm gehörte, gekauft. Um einen Spottpreis. Der Turm war nicht verbunden mit der Burg, stand abseits des wehrhaften, etwas düsteren Baus. Fast im Wald. Und Klara hatte beschlossen, in genau diesem Turm zu wohnen. Ein Wohnturm also. Oder ein Wehrturm, ein Hungerturm, der Turm von Rapunzel mit den langen Haaren, ein Narrenturm, der Turm von Hölderlin, dem wahnsinnigen Dichter. Am ehesten ein Elfenbeinturm. Ein verträumter Rundturm jedenfalls. Die Schießscharten waren zu Fenstern ausgebaut worden, die maßgezimmerten Möbel passten sich der Rundung der Wände an. Auch eine Terrasse mit Ausblick auf den Ort Karberg hatte Klara anbauen lassen.
An schönen Tagen ging sie zu Fuß zur Arbeit, einen kurzen, schottrigen Fahrweg von der Turmwohnung aus talwärts. Dann noch ein Stück längs der Bundesstraße.
War das Wetter schlecht, fuhr sie mit ihrem kleinen, alten Citroën bis zur Buchhandlung, ihrer Buchhandlung.
Klaras Freund wohnte am anderen Ende der Stadt, ein verlässlicher Freund, der Distanz halten konnte, wenn sie es brauchte, der freundschaftlich mit ihr umging, der sie nicht jeden Tag in Beschlag nahm. Wenn sie zu ihm wollte, brauchte sie nur die Fahrt bis über die Buchhandlung hinaus fortzusetzen. In der kleinen Stadt Karberg war alles nah und übersichtlich.
Klaras Freund. Er wohnte nicht allzu weit von ihr entfernt, war Musiker. Er spielte in einem klassischen Quartett in der Hauptstadt. Mit Hingabe, mit Ernst, mit Leichtigkeit. Schubert, Brahms, Mozart, Haydn, das waren seine Freunde, seine Vertrauten. Komponisten, die jeder kannte. Es gab keine Überraschungen, und mit diesen Musikkumpanen fühlte Hannes sich sicher. Die Musik war alles für ihn. Fast alles. Da war noch Klara, die genau wusste, wie fern er ihr eigentlich war. Aber sie wollte es so, genau so. Hannes redete nicht viel, weil er mit Worten nicht gut zurechtkam. Sie waren kein Ausdrucksmittel für ihn, es sei denn, er fand mit Klara ein gemeinsames musikalisches Thema. Dann brannte er. Manchmal.
bevor der letzte Satz geschrieben ist.
(Joyce Carol Oates)
1
Durch knöchelhohes Laub stapfte sie. Es war kalt, der Atem in der Sonne sichtbar. Goldene Blätter in den Bäumen, gleich würden sie fallen. Blattgold am Boden. Fast sank sie ein im Laubmeer.
Es war wie das Wattenmeer, mit hartem Sand unter den Füßen. Erinnerung an Wind im Norden, vor vielen Jahren.
Die leichten, toten Blätter des Sommerendes schwebten schaukelnd zu Boden, zerbrechliche Gebilde. Sie trat darauf, vorsichtig zwar, aber sie trat darauf. Kein einziges der Blätter wurde von Klara dabei verletzt oder getötet. Das Laub war unverletzbar. War schon tot.
Der Frost knisterte wie Seidenpapier unter ihren Fußsohlen. Spiegelung des heute besonders großen sonnenblauen Himmels in diesem raschelnden, goldroten Meer, aber nur, wenn sie der Sonne entgegenging, immer entgegenging.
Blätter, die derart strahlten, das hatte sie zuvor noch nie gesehen. Sie würde nächste Nacht nochmals hierherkommen und sehen, ob diese Blätter auch im Dunkeln leuchteten. Wie fluoreszierende zarte Tierchen am Grund des Meeres, weit außerhalb des Watts.
Was wäre, wenn sie einsinken würde in diesem Blättermeer? Wie im Watt bei Flut. Wenn es keinen Halt mehr gäbe unter den Füßen. Trotzdem. Angst vor dem Versinken hatte sie nicht, eher die Sehnsucht danach.
Ein paar Schritte weiter fielen die Blätter plötzlich nicht aus den Bäumen nach unten. Nein. Es war umgekehrt. Das goldene, noch nicht ganz vertrocknete Laub erhob sich im leichten Wind vom Boden, tanzte schwerelos aufwärts, tanzte durch die kalte Luft hinauf in die Äste zweier Birken, blieb an den weißen Zweigen hängen, leuchtete stärker, je höher es sich im Geäst ansiedelte. Die Stämme der Birken waren kaum zu sehen, nur die Blätter. Blätterwolke statt Blättermeer.
Zwischen den Birken hing Jesus am Kreuz. Jesus, umrahmt von den dünnädrigen, aufwärts fliegenden Blättern, die der Kreuzestod nicht kümmerte.
Klara glaubte nicht an Gott, doch die Gestalt seines Sohnes vor ihr, der Gekreuzigte und das Blattgold um ihn herum, das war eindrucksvoll. Zugegeben.
Neben Jesus lag still ein verwilderter Garten. Ein unbeschnittener Apfelbaum nahe am Zaun. Die überreifen, verfaulten Äpfel waren ins Gras gefallen, noch immer rotbäckig, aber matschig weich mit braunen Flecken, angeschimmelt. Sicher wohnten Würmer in diesen Äpfeln, hell, farblos, dünner als Maden.
Was, wenn diese Würmer zu Jesus krochen? Auf dem Kreuzbalken hinauf, zuerst zu den Füßen, dann in seinen Körper. Ein bisschen Leben in ihm, dem toten Nazarener. Wurmstichiges Leben.
Da mahnte Klaras Armbanduhr. Kaltbeschlagene Uhr, die angehaucht werden musste, um die Zeit anzuzeigen. Klara wollte zurück, zurück ins Leben ohne Goldlaub und ohne Würmer.
Ins warme Leben.
In ihren Turm.
Fast hätte sie Jesus zum Abschied gegrüßt, aber wie grüßt man einen Gekreuzigten? Einen an hohes Holz Genagelten?
Auf ihrem Weg nach Hause machte sie sich Sorgen um diesen Jesus von Nazareth. Er hatte ja wirklich gelebt, daran zumindest glaubte sie.
Ob die gelbbraunen Birkenblätter, die Jesus an diesem Herbsttag umrahmten, ihn berührten, wenn sie zu Boden fielen? Oder ob sie wegblieben von ihm, weg von seinem Leib? Es könnte ja sein, dass eine verletzbare Stelle an seinem Körper entstand, wenn sich ein Blatt an seine Schulter heftete. An die Schulter wie bei dieser Sage um Siegfried. Siegfried im Blut des Drachen badend, ein Lindenblatt auf der Schulter, an dieser Stelle verletzbar. Und hier der nackte Jesus, fast überall unverwundbar. Nur an dieser einen Stelle, an die sich das Blatt heftete, würde man ihn töten können.
Aber Jesus war ja längst tot, also ohnehin nicht mehr verwundbar. Man musste sich keine Sorgen machen, auch Klara nicht. Menschen haben ihn zu Tode gehetzt. Ein Speer von Menschen, ein Kreuz, von Menschen gezimmert. Und jetzt hing er als schmerzensreiche Holzfigur am Rand von Klaras Weg.
Warum hatten so viele Menschen einen gehetzten, zu Tode gekreuzigten Erlöser ausgesucht, um ihn in ihre Zimmer, ihre Schulklassen zu hängen. Ein Verbrechen, fortwährend sichtbar. Warum verehrten sie nicht einen lächelnden, genießenden Gottessohn? Einen Gottessohn, der in Freude strahlt. Warum diese Marter?
Nein, so mochte Klara ihn nicht, so leidend. Sollte er doch weiter hier hängen, Erlösung hin oder her. Es war ihr egal.
Heimwärts, mit Haube und kaltsteifen Händen in den Taschen, sichtbare Atemluft vor der Nase, ein kaltes Prickeln auf der Stirn, dort, wo die Haube endete.
Anderntags packte sie ihre reichlich vorhandenen Acrylfarben zusammen, einen Kübel mit Wasser, einen dicken Pinsel. Sie ging den Weg zum Gekreuzigten hinauf, stieg auf die wackelige Bank, die unter Jesu Füßen stand, und lockerte die ohnehin nur mehr leicht verankerten, verrosteten Schrauben, die durch die Hände des Gottessohns gebohrt worden waren, von wem auch immer. Vorsichtig hob sie die hölzerne Figur vom Kreuz. Jesus war leichter als gedacht. Weg vom Kreuz hob sie ihn. Bettete ihn ins Gras. In die Sonne.
Und dann malte sie. Sie bemalte Jesus mit grünen, grellroten, in pink schillernden und gelben Farbinseln, umhüllt von tiefem Blau. Ein türkiser Ozean breitete sich auf Jesu Brust aus. Klara band ihm ein Tuch mit weißen Sternen auf rotem Grund um seine Stirn. Wie in Woodstock damals, wo dieser Jesus sicher anwesend war. Unsichtbar zwar, aber anwesend.
Da lag er nun, geschmückt mit bunten Linien und Flecken und mit einem Stirnband. Klara hob ihn wieder hinauf auf seinen angestammten Platz, betrachtete ihr farbiges Werk.
Sicher war Jesus Christus jetzt glücklicher auf seinem Kreuz.
Sicher.
Niemand hatte Klara gesehen.
Ihre Finger waren voller Farben, wie das Lendentuch des Nazareners. Sie lächelte ihn an. So einem Gottessohn konnte sie zulächeln. So einem schon.
2
Alina war anders als ihre Kolleginnen im Krankenhaus. Sie klagte nie über die Arbeit, fluchte aber mitunter leise. Fluchte, wenn der alte Herr im Zimmer 6 glaubte, ihr an den Hintern greifen zu dürfen. Fluchte, wenn das junge Ding im Zimmer 7 die Pflegerinnen ständig um irgendetwas bat. Fluchte, aber meinte es nicht so. Sie reagierte dabei die Belastung ab, unter der sie alle litten. Alina am wenigsten. Vielleicht weil sie fluchte.
Sie war vor 10 Jahren aus ihrer Heimat hierhergekommen. Hatte sofort Arbeit gefunden. Gute Krankenpflegerinnen waren gesucht. Wenn man sie fragte, woher sie und ihre Tochter kämen, sagte sie nur:
„Aus dem Land unter den Bomben“
Sie konnte den Namen ihres Heimatlandes nicht aussprechen, ohne dass ihre Stimme zitterte. Also Bombenland.
Nach der Trennung von Sadec hatte sie den Mädchennamen ihrer deutschen Mutter wieder angenommen: Schuhman. Ihr Vater hatte die Mutter zu einem durchsichtigen, willenlosen Wesen gemacht, darum wählte sie Mutters Mädchennamen. Genau darum. Vielleicht wollte sie die Mutter im Nachhinein retten, wenigstens ihren Namen dingfest machen. In Alinas Heimat hieß niemand Schuhman. Da hieß man Selinki, Worslow, Charinko. Jetzt aber hieß Alina Schuhman. Ihr gewalttätiger Vater war vor Jahren ums Leben gekommen. Unfalltod.
Schuhman – ein schöner Name. So rund und geschmeidig, fand Alina.
3
Bei einem gemeinsamen Spaziergang in der Mittagspause entdeckten Alina und ihr Freund Ralph einen bemalten Gottessohn. Der hölzerne Jesus, der da schon lange ruhig neben dem Weg hing, war mit bunten Farben beschmiert worden, von wem auch immer. Alina war entsetzt von so viel Respektlosigkeit. Sie empfand es als Vandalismus, den Gekreuzigten so herzurichten. Gut, sie war nicht gläubig, aber so eine Blasphemie wollte sie keinesfalls zulassen. Ralph fand zwar, dass sie sich raushalten sollten aus dieser Sache, aber Alina bestand darauf, Jesus wiederherzustellen.
Sie pflückten ihn ab von seinem morschen Kreuz, putzten ihn mit großen rauen Blättern, die neben dem Weg wuchsen, hängten ihn wieder an seinen Platz. Er war nun wieder Braun in Braun zu sehen. Nicht bunt.
Zu ihrer Arbeit im Spital kamen sie nach der Mittagspause gerade noch zurecht.
4
Wenn Alina ins Krankenhaus zur Arbeit fuhr, wählte sie immer den gleichen Weg. Rasch vorbei am Kindergarten, wo sie manchmal zwei Mädchen, die am Zaun winkten, kurz zuhupte. Es klang wie „Grüß euch, ihr beiden“. Sie fuhr vorbei an der Feuerwehr, am Röntgeninstitut, an der „Lebenshilfe“. Jedes Mal erinnerte sie sich an eine Freundin, deren Sohn in solch einer Werkstatt lebte. Die Operation, der sich der Bub als Baby hatte unterziehen müssen, war ihm zum Verhängnis geworden. Etwas zu viel Narkose, und schon war das Kind nicht wie andere Kinder. Es sah die Welt anders als andere Leute, vielleicht sogar bunter, vielfältiger. Es sah die Menschen anders an, betrachtete sie aus anderen Augen. Wie genau, das wusste niemand so recht. Das Wichtigste war, dass er selbst nicht sah, dass er anders war. Er war glücklich in seiner Welt.
Der Bub, inzwischen ein Mann, lebte schon lange so.
Alina war meist in Eile. Sie wusste, dass sie pünktlich zu ihrer Schicht erscheinen musste. Man brauchte im Krankenhaus jeden Pfleger, jede Pflegerin. Es waren schlechte Zeiten für Spitäler. Trotz der Belastung mochte Alina ihren Beruf, auch wenn er sehr anstrengend war. Manchmal wollte sie sich einfach zu einem Patienten ins Bett legen, entspannen, schlafen. Und manchmal wollte sie, wie die anderen auch, höheren Lohn für ihre Arbeit. Trotzdem. Alina war zufrieden.
Aus jenem Land, in dem jetzt schon lange Krieg war, war sie geflohen. Vor zehn Jahren. Geflohen mit ihrer Tochter Dina. Dina war gerade sieben geworden damals. Ihr schlechtes Gewissen wischte Alina weg. Das Gewissen, das ihr vorwarf, sie habe überlebt und andere nicht. Nein. Es war richtig gewesen zu fliehen. Die Tochter war zwar anfangs betrübt gewesen, hier in diesem fremden Land ohne ihre Freundinnen. Aber bald hatte sie neue gefunden, hatte Fuß gefasst im Friedensland. Und hier in Karberg, hier brauchte man Alina.
Von ihrem Mann Sadec war sie schon sehr lange getrennt. Er hatte im Bombenland bleiben müssen. Generalmobilmachung.
„Er ist im Krieg geblieben“, antworteten Alina oder ihre Tochter, wenn sie gefragt wurden. Das hieß in Wirklichkeit Tod im Häuserkampf, im Schützengraben, aus dem Hinterhalt. Die Worte „Er ist im Krieg geblieben“ verschwiegen das Grauen und das Sterben. Klangen glatt. Glatt wie Eis, unter dem es dunkel war und kalt.
Es war einer Freundin aus ihrer Heimat zu verdanken, dass Alina die deutsche Sprache heute perfekt beherrschte. Die Freundin war schon lange hier in Karberg, und sie hatte Alina gedrängt und gestoßen. Gedrängt, in einen Sprachkurs zu gehen. Und Alina war begabt. Es gelang. Sie sprach fast ohne Akzent. Auch ihrer Tochter Dina war ihre Herkunft kaum anzumerken.
Alina war im Spital angelangt. Vorbei der Kindergarten, das Röntgeninstitut, die „Lebenshilfe“. Schnell in ihre weiße Arbeitskleidung und rasch hinauf in den 1. Stock, wo ihre Krankenstation auf sie wartete.
5
Klara wohnte in einem Turm, einem runden Turm. Freunde hatten die renovierungsbedürftige Burg, zu der dieser Turm gehörte, gekauft. Um einen Spottpreis. Der Turm war nicht verbunden mit der Burg, stand abseits des wehrhaften, etwas düsteren Baus. Fast im Wald. Und Klara hatte beschlossen, in genau diesem Turm zu wohnen. Ein Wohnturm also. Oder ein Wehrturm, ein Hungerturm, der Turm von Rapunzel mit den langen Haaren, ein Narrenturm, der Turm von Hölderlin, dem wahnsinnigen Dichter. Am ehesten ein Elfenbeinturm. Ein verträumter Rundturm jedenfalls. Die Schießscharten waren zu Fenstern ausgebaut worden, die maßgezimmerten Möbel passten sich der Rundung der Wände an. Auch eine Terrasse mit Ausblick auf den Ort Karberg hatte Klara anbauen lassen.
An schönen Tagen ging sie zu Fuß zur Arbeit, einen kurzen, schottrigen Fahrweg von der Turmwohnung aus talwärts. Dann noch ein Stück längs der Bundesstraße.
War das Wetter schlecht, fuhr sie mit ihrem kleinen, alten Citroën bis zur Buchhandlung, ihrer Buchhandlung.
Klaras Freund wohnte am anderen Ende der Stadt, ein verlässlicher Freund, der Distanz halten konnte, wenn sie es brauchte, der freundschaftlich mit ihr umging, der sie nicht jeden Tag in Beschlag nahm. Wenn sie zu ihm wollte, brauchte sie nur die Fahrt bis über die Buchhandlung hinaus fortzusetzen. In der kleinen Stadt Karberg war alles nah und übersichtlich.
Klaras Freund. Er wohnte nicht allzu weit von ihr entfernt, war Musiker. Er spielte in einem klassischen Quartett in der Hauptstadt. Mit Hingabe, mit Ernst, mit Leichtigkeit. Schubert, Brahms, Mozart, Haydn, das waren seine Freunde, seine Vertrauten. Komponisten, die jeder kannte. Es gab keine Überraschungen, und mit diesen Musikkumpanen fühlte Hannes sich sicher. Die Musik war alles für ihn. Fast alles. Da war noch Klara, die genau wusste, wie fern er ihr eigentlich war. Aber sie wollte es so, genau so. Hannes redete nicht viel, weil er mit Worten nicht gut zurechtkam. Sie waren kein Ausdrucksmittel für ihn, es sei denn, er fand mit Klara ein gemeinsames musikalisches Thema. Dann brannte er. Manchmal.