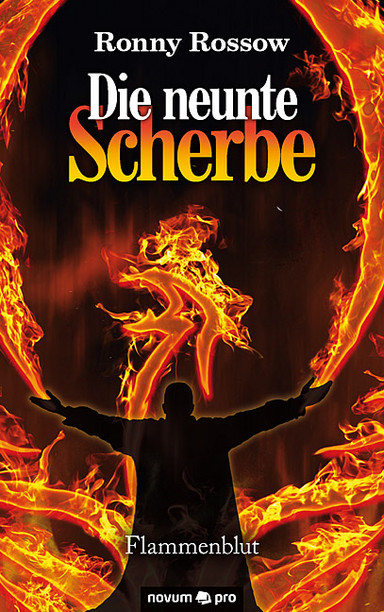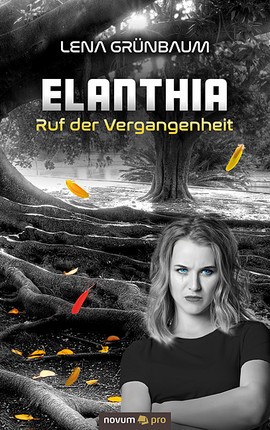Die neunte Scherbe
Flammenblut
Ronny Rossow
EUR 21,90
EUR 13,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 566
ISBN: 978-3-95840-865-4
Erscheinungsdatum: 24.10.2019
Während Westammar im Intrigenspiel der Mächtigen zu zerbrechen droht, ist Aska weiterhin fest entschlossen, ihren Bruder zu finden. Und dafür ist ihr jedes Mittel recht - selbst die unheimliche Macht, die allmählich in ihr erwacht.
Prolog
Hochverehrter Kanzler Rowynn,
ich hoffe inständig, dieses Sendschreiben erreicht Euch bei guter Gesundheit. Zugleich möchte ich Euch mein tiefes Bedauern darüber ausdrücken, dass ich so lange dem Hofe ferngeblieben bin. Wenn ich mich recht entsinne, sind es nun beinahe sechs Jahre, seit ich Euch und Eure Familie zuletzt sah. Alwyn, Euer Jüngster, war damals gerade erst den Windeln entwachsen, und nun, wenn er auch nur das Geringste von Eurer Kraft in sich trägt, wird er wohl bereits mit dem Holzschwert üben.
Natürlich ist es überwiegend die Pflicht, die mich vom höfischen Treiben fernhält, doch ich muss gestehen, dass ich mich umso lieber hinter dieser Pflicht verstecke, je mehr der Weggefährten von einst die letzte Fahrt antreten. Kaum noch ein bekanntes Gesicht bei Hofe, kaum noch einer, der des Vergangenen gedenkt. Die Alten entsinnen sich nicht mehr oder versuchen zu vergessen. Und die Jungen schreiben ihre eigene Geschichte.
Es erfüllt mich stets mit Bedauern, feststellen zu müssen, dass ich selbst langsam zu Geschichte werde. Dass die Dinge, die mir des Nachts so klar vor Augen stehen, wenn mir Träume und Erinnerungen den Schlaf rauben, mit der Zeit zu Wörtern verkommen, die zwischen staubigen Buchdeckeln langsam in Vergessenheit geraten.
Umso überraschter war ich natürlich, als mich vor zwölf Monaten Euer Brief und Eure Bitte erreichten. Ich befand mich zu jener Zeit oben in Kaz Durval und leitete archäologische Ausgrabungen, wie Ihr Euch sicher erinnert. Wir hatten gerade erst den Kartenraum entdeckt, und Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass ich alle Hände voll zu tun hatte. Es ist eine Schande, dass die Arbeiten dort mittlerweile eingestellt wurden. Es gibt noch so vieles, das wir von den Ersten lernen könnten, mein Freund!
Erinnert Ihr Euch noch der ersten Jahre nach dem Großen Brand? Bücher wurden damals gehandelt wie Gold. Die Schreiberlinge konnten sich kaum retten vor Aufträgen. Heute klammert sich niemand mehr an das alte Wissen. Erzähltes wurde zu Geschichte, genau wie die Erzähler selbst, und nunmehr wird Geschichte zu Legende. Zu Märchen, die brave Eltern im Schein der Kerzen ihren Kindern erzählen, bevor sie schlafen gehen.
Ihr tut dies nicht, könnte ich mir vorstellen. Ihr erinnert Euch noch, wie wenige echte Helden es damals wirklich gab, und wie wenige Taten es wert waren, besungen zu werden. Das wenige an Wahrheit wurde mit Blut fortgewaschen, und unsere Kinder könnten nie wieder schlafen, wenn wir ihnen erzählen würden, was sich zu jener Zeit wirklich zugetragen hatte.
Ich gestehe, dass ich bis ins Mark gespalten bin, wenn ich meinen eigenen Jungen ansehe. Er ist mittlerweile verheiratet, und im letzten Sommer ist er selbst Vater geworden. Ich bin nun Großvater, könnt Ihr Euch das vorstellen? Und wenn ich an den warmen Abenden im Garten oder in den kalten Winternächten am Kamin bei ihnen sitze, denke ich bisweilen, wie unsinnig mein Bestreben ist. Die Welt hat Recht, wir sollten vergessen, anstatt zu versuchen, uns zu erinnern. Wir sollten die letzten Bücher verbrennen, die letzten Lieder verbieten, bis sich der Schlaf auch auf die letzten Erinnerungen gelegt hat.
Doch wie sollten wir diejenigen, die nach uns kommen, dann vor unseren eigenen Fehlern schützen? Was können wir ihnen hinterlassen außer Legenden und einem schlechten Gewissen? Wie schützen wir unsere Kinder am besten vor unserer eigenen Torheit, Markess? Erinnerung oder Vergessen? Bisweilen, in besonders einsamen Stunden, ertappe ich mich dabei, wie ich noch immer bete. Und dann überkommt mich jedes Mal tiefe Traurigkeit, wenn ich mich erinnere, dass niemand mehr da ist, der zuhört.
Verzeiht meine trübsinnigen Gedanken, mein Freund. Ich befürchte, die Erfüllung Eurer Bitte hat mich doch mehr Kraft gekostet, als ich mir bislang selbst einzugestehen bereit war. Damals, als ich Euren Brief zum ersten Mal las, steckte noch wesentlich mehr Idealismus in mir. Ich ließ Schaufel und Pinsel fallen, um den Bericht anzufertigen, den Ihr anbei finden werdet und der hoffentlich Eure offenen Fragen nach den Geschehnissen beantworten wird. Ich habe mich bemüht, nicht nur mein eigenes Wissen niederzuschreiben, sondern jede Quelle zu nutzen, die mir noch verblieben ist. Für die historischen Fakten verbürge ich mich selbstverständlich. Doch trotz aller Akribie basieren einige Teile des Berichtes – hauptsächlich diejenigen, die sich mit dem Warum befassen – auf Vermutungen, auf Gerüchten und Hörensagen.
Ich muss Euch warnen, Markess. Was Ihr als nüchternen Tatsachenbericht angefordert habt, ist mir wohl über die Monate entglitten. Tatsachen und Wahrheit, mein Freund, sind nicht dasselbe. Und obwohl Ihr klar das Erstere erbeten habt, konnte ich nicht anders, als Euch Letzteres zukommen zu lassen. Da Ihr mit Eurer Bitte jedoch an mich herangetreten seid und an keinen anderen, darf ich annehmen, dass Ihr diese Eventualität bereits berücksichtigt hattet, als Ihr Euren Brief verfasstet.
Verzeiht bitte auch, wenn ich Eure eigene Rolle inmitten der Begebenheiten weit weniger romantisiere als die jungen Burschen hinter den Mauern dessen, was sie heute Akademien nennen. Ich weiß, dass Ihr Euren Platz in der Geschichte kennt und dass es Euch kaum schwerfallen dürfte, diesen Teil der Wahrheit zu akzeptieren.
Was den Rest anbelangt, musste ich jedoch weit tiefer graben, als Ihr es eigentlich verlangt hattet. Viele der Zusammenhänge wurden mir erst bewusst, während ich nach und nach das Bild zusammenfügte, und viele der kleineren Details stellten sich erst bei näherer Untersuchung als so bedeutsam heraus, dass ich sie Euch nicht vorenthalten konnte. Die Wahrheit ist, dass am Ende die Details weit wichtiger sind als das Gesamtbild, denn sie sind es, die das Warum erklären. Und sie sind letzten Endes auch der Grund, warum ich noch immer bete, obwohl niemand mehr zuzuhören scheint.
Mein Bericht geht daher zurück bis zum ersten Tag des Monats des Morgensterns, dem Ilwaton, dem Tag nach der Tränenschlacht, in der die Nordgrenze fiel. Ich werde Euch nicht erneut mit Korrekturen zu den sogenannten historischen Aufzeichnungen über die Schlacht um Kor Drakar langweilen; entsprechende Vermerke konntet Ihr bereits meinem letzten Bericht entnehmen. Dennoch knüpfen die relevanten Begebenheiten, die den Ereignissen, die Euch interessieren dürften, zugrunde liegen, so nahtlos an jenen Tag an, dass es kaum ein Zufall sein dürfte.
Mein Bericht beginnt jedoch nicht in den brennenden Überresten der Eisernen Stadt, nicht einmal innerhalb der Grenzen Westammars, und auch nicht mit großen Namen. Mein Bericht beginnt stattdessen mit einem jungen Mädchen, auf einem Schiff irgendwo inmitten des Namenlosen Meeres …
Das Namenlose Meer
Aska blinzelte verschlafen in das grelle Sonnenlicht, das sie auf dem Deck der „Sturmkrähe“ in Empfang nahm. Sie hatte geschlafen, nur die Götter wussten, wie lang, doch sie fühlte sich kein bisschen erholt. Sie war in der Dunkelheit unter Deck zu sich gekommen, mit steifen Gliedern und zum Bersten voller Blase. Ihr Kopf fühlte sich von den scharfkantigen Träumen und Erinnerungen an, als wäre er mit zerstoßenem Glas gefüllt, und vom Schlingern des Bodens drehte sich ihr der Magen um. Sie war dem Stimmengewirr gefolgt, bis sie schließlich die Treppe gefunden hatte, und nun stach ihr das Licht des Tages so gleißend in die Augen, dass sie sich am liebsten übergeben wollte.
„Obedt!“, herrschte sie ein Mann an, der sich mit nacktem Oberkörper und einem kleinen Fass auf der muskulösen Schulter an ihr vorbeidrängte.
Sie erschrak und stammelte lediglich: „Verzeihung!“
Ein anderer Mann, der sich gerade an der Takelage zu schaffen machte, drehte sich zu dem Fassträger um.
„Dar Kinnen warde nit herden, Janne!“, lachte er schallend.
„Win skard op den Ammari. Op beyden!“, brummte der Kerl mit dem Fass ungehalten und spuckte unflätig aus.
„Sie sprechen die Stimme des Scherbenvolkes nicht“, hörte sie eine gequälte Stimme zu ihrer Rechten. „Und ich verstehe genug Imerisch, als dass ich wirklich wissen wollte, was er gerade gesagt hat.“
Aska sah hinüber zu der niedrigen Reling, und dort, unweit des Aufganges zur Brücke des Schiffes, lehnte der schwarzgekleidete Mann, den Kopf über das Meer gebeugt, sodass Aska sein Gesicht nicht sehen konnte. Sie tat einen Schritt auf ihn zu, und noch während sie den säuerlichen Geruch bemerkte, der die dunkle Gestalt umwehte wie die böse Verkehrung eines Parfüms, übergab der Mann sich keuchend und so heftig, als wolle er seine Innereien in die Gischt spucken.
„Boros sei mir gnädig“, hauchte er. „Ich hasse das Meer!“
Aska hielt höflich Abstand und gab ihm einen Augenblick, sich nach der Attacke wieder zu sammeln. Währenddessen warf sie einen Blick über das Deck und die Mannschaft, die es bevölkerte. Die „Sturmkrähe“ war kein besonders großes Schiff, eine zweimastige, pummelige Brigg, und ihre Mannschaft schien ein zusammengewürfelter Haufen von Matrosen aus allen möglichen Ländern zu sein. Aska sah hauptsächlich weißhäutige Imerier, aber dazwischen auch einen riesigen, muskelbepackten Dowari, ein paar bronzefarbene Ashuri und das Blond der Westlinge.
Als der Atem des Mannes sich langsam wieder beruhigte, trat sie entschlossen einen weiteren Schritt auf ihn zu.
„Ich hatte noch keine Gelegenheit, Euch zu danken“, sagte sie und meinte es ernst, obwohl ihr der Sinn gerade kaum nach Höflichkeit stand. Ihr eigener Magen rebellierte beim Geruch des Erbrochenen, doch sie war fest entschlossen, zunächst dem Anstand Raum zu geben, bevor sie sich zweifellos zu dem Mann gesellen würde.
„Bei den Göttern!“, murmelte der Mann und drehte sich langsam um.
Aska erschrak so heftig, dass sie beinahe das Gleichgewicht verloren hätte, als sie das Gesicht des Mannes erblickte.
„Deine Dankbarkeit interessiert mich einen Rattenschiss!“, fuhr er sie böse an, und die Narben auf seiner Haut gerieten in Bewegung wie Steine bei einem Erdrutsch.
Sein Gesicht war vollkommen verbrannt, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Für einen Moment glaubte Aska, in einen bösen Spiegel zu blicken, doch verglichen mit ihm war ihr eigenes Gesicht unter der Maske wohlgeformt. Über seiner rechten Wange klaffte ein riesiges Loch und legte die darunterliegenden Zähne frei, sodass es den Anschein hatte, er würde sie angrinsen. Von seiner Nase waren lediglich noch ruinenhafte Reste übrig. Etwas unsagbar Grauenhaftes musste diesem Mann zugestoßen sein, und einzig seine Augen schienen davon verschont geblieben zu sein.
Seine Augen. Die Augen eines Raubvogels. Eines Falken! Die Erinnerung traf sie so heftig, so grell und brutal, dass sie für einen Augenblick nicht atmen konnte. In diesem Augenblick lag der Duft von süßen Fladen über dem salzigen Geruch des Meeres, und Derrens Flötenspiel klang in den Wellen, die sacht gegen den Bug schlugen. Irgendwo hinter ihr sang ein Scherenschleifer ein fröhliches Lied, und Aska konnte das Kreischen des Metalls auf dem Schleifstein hören.
„Ihr“, presste sie mühsam hervor, „Ihr ward dort!“
Seine Augen durchbohrten sie förmlich, und ein unsagbarer Hass lag darin, der offensichtlich ihr galt.
„Zu meinem endlosen Bedauern, ja“, knurrte er, und die Zähne unter dem rotgeränderten Loch in seiner Wange mahlten unablässig.
Sie spürte, dass etwas Boshaftes von ihm ausging, ihn umwehte wie zuvor der säuerliche Gestank seines Mageninhaltes, doch für den Moment spürte sie keine Angst, nur abgrundtiefe Fassungslosigkeit.
„Dann seid Ihr ein Reiter Brymkasts?“, fragte sie aufgeregt, denn sie konnte noch immer nicht glauben, dass dies der Mann sein sollte, den sie vor einem halben Leben in Raunwald gesehen hatte, kurz bevor das Feuer ausgebrochen war.
„Das war ich einmal“, entgegnete er knapp, und plötzlich lag tiefe Traurigkeit in seiner Stimme.
Sie spürte, dass er noch mehr dazu zu sagen hatte, hielt es jedoch für unangebracht, ihn zu drängen. Er war aufgewühlt, und angesichts seines Zustandes war das auch kaum verwunderlich. Stattdessen wechselte sie das Thema, stellte ihm die eine von den tausend Fragen, die ihr am meisten auf der Seele brannte.
„Ihr kanntet meinen Vater?“, fragte sie leise.
Er starrte sie an, mehr noch durch sie hindurch, als wenn hinter ihr die Vergangenheit Gestalt angenommen hätte.
„Ja, ich kannte Dargo“, entgegnete er einsilbig.
Erinnerungsschwangere Stille legte sich zwischen sie, so dicht, dass selbst das Lärmen der Matrosen in weite Ferne zu rücken schien. Er schlug die Augen nieder, bevor er traurig fortfuhr.
„Er war ein tapferer Mann. Vielleicht der tapferste, den ich je gekannt habe. Er hat Opfer gebracht, zu denen ich selbst nie bereit war.“
Die grauen Augen inmitten des zerstörten Gesichtes hefteten sich erneut an Askas Blick, doch diesmal lag kein Zorn darin, nur Bedauern, bodenlos und tiefschwarz.
„Er hat sie für dich gebracht, Kind!“
Sie erinnerte sich an die letzten Momente, an die schrecklichen Wunden in Vaters Gesicht, bevor er sie verlassen hatte. Sie erinnerte sich an das Feuer, das sich durch ihre Kleider, durch ihre Haut und ihr Fleisch bis in ihre Seele gefressen hatte. Doch am deutlichsten erinnerte sie sich an die Liebe in Vaters letztem Blick, an das warme Gefühl, das seine Opferbereitschaft in ihr ausgelöst hatte, dort, inmitten von Leid und Tod und Zerstörung.
„Er ist für mich gestorben“, sprach sie laut den einen Gedanken aus, von dem sie plötzlich erfüllt war, und dicke Tränen liefen unter ihrer Maske herab.
„Mehr noch“, entgegnete Falkenauge. „Er hat für dich gelebt!“
Dann sah er sie an, sah mitten in sie hinein, bevor er weitersprach.
„Aber dein Vater war er nicht.“
Etwas in Askas Seele zerriss mit einem lauten, kreischenden Geräusch, das nur sie selbst hören konnte. Bevor sie es bemerkte, sank sie auf die Knie, während ihr Innerstes langsam auseinanderbrach wie eine Eisscholle im Sommer. Die Frau, die sie erst viel später hätte werden sollen, stand auf der einen Seite dieser Kluft, und diese Frau wusste, dass der fremde Mann keinen Grund hatte, sie anzulügen. Mehr noch, sie spürte, dass er die Wahrheit sagte. Doch das Kind in ihr, das jenseits des breiter werdenden Abgrunds langsam in die Dunkelheit trieb, das Kind, das seinen Vater verehrt, seinen Bruder geliebt hatte, wollte davon nichts wissen.
„Ihr lügt!“, brüllte sie ihm trotzig in sein hässliches Gesicht.
Er durchmaß den Raum zwischen ihm und ihr mit wenigen Schritten und ohrfeigte sie so hart, dass sie auf den feuchten Planken des Decks zu Boden ging. Ihre Maske flog davon, schlitterte über das harte Holz und blieb einen Meter vor ihr liegen. Panisch kroch sie zu dem weißen Ding hinüber, das nun ihr Gesicht geworden war, und während sich glühender Schmerz auf ihrer Wange ausbreitete, streifte sie die Maske erneut über und richtete in aller Eile ihre Kapuze, bevor sie sich angsterfüllt wieder zu ihm umdrehte. Er kniete direkt vor ihr und funkelte sie hasserfüllt an.
„Hör gut zu, Mädchen!“, fauchte er, und seine grauenhafte Fratze war so nah an ihrem Gesicht, dass sie seinen sauren Atem riechen konnte. „Dargo war nicht dein Vater, Halyanna nicht deine Mutter, Thomas nicht dein Bruder. Dein ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Du bist nichts weiter als eine Missgeburt, eine üble Laune der Götter, und wäre ich nicht an meinen Eid gebunden, würde ich dir selbst die Kehle durchschneiden für das, was du bist!“
Zorn stieg in ihr hoch, breitete sich vom Zentrum ihres Herzens aus wie eine Flamme, die sich langsam durch sie hindurchfraß. Die Angst, die sie vor diesem Ungeheuer empfand, wurde von ihrem Zorn erfasst und binnen eines Augenblicks zu weißer Asche verbrannt.
„Und was bin ich?“, krochen die Worte wie giftige Schlangen über ihre Lippen.
„Du bist ein Monster“, erwiderte er kalt und deutete auf ihre Hände.
Sie sah an sich herab auf ihre Handflächen, und kleine, blassblaue Flämmchen tanzten darauf, bildeten langsam orangefarbene Ränder. Und noch während sie erschrocken die Fäuste ballte, um das Feuer zu ersticken, hob er sie schroff auf die Beine und zog sie unsanft mit sich.
Als sie kurz darauf in der Dunkelheit der Mannschaftsquartiere saß und ihn dabei beobachtete, wie er irgendeine scheußlich stinkende Flüssigkeit in sich hineinkippte, fühlte sie rein gar nichts mehr. Das Kind in ihr war verstummt, die Frau verschwunden, und übrig blieb nur der gähnende Abgrund in ihrer zerbrochenen Seele.
„Ich kann dir nicht sagen, was du bist“, fing er mit schwerer Zunge an zu erzählen. „Dargo hat es mir einmal erklärt, doch das ist fast neun Jahre her. Doch ich bin es ihm wohl schuldig, es wenigstens zu versuchen. Du weißt sicher, dass es Menschen gibt, die die Kräfte der Scherben kontrollieren können, oder?“
„Ihr meint die Priester?“, fragte sie vorsichtig, um ihn nicht erneut zu verärgern.
Doch für den Augenblick schien seine Wut verraucht zu sein, begraben unter Trauer und Selbstmitleid.
„Ganz recht, die achtmal verfluchten Priester“, antwortete er lallend. „Doch selbst die Besten unter ihnen benötigen oft viele Jahre der Übung, bis sie auch nur einen kleinen Teil der Macht der Götter für sich beanspruchen können. Die meisten dienen dem Glauben ihr Leben lang, ohne jemals von den Scherben berührt zu werden. Andere benötigen Drogen oder Wut oder Meditation, um ihre Magie wirken zu können.“
Sie nickte kurz. Das alles hatte sie noch von Bramquists endlosen Stunden der Scherbenlehre behalten.
„Einige wenige allerdings werden mit der Gabe geboren“, fuhr er fort. „Sie können Feuer, Wasser oder Stein manipulieren, ohne es jemals erlernt haben zu müssen. Meistens erreichen diese Berührten hohe Ränge in den Scherbenorden. Viele Archonen waren und sind Berührte. Dein Freund Callo Varras gilt ebenfalls als einer von ihnen.“
„Wer?“, unterbrach sie verständnislos.
„Das Ungeheuer, das dich in der Stadt in Stücke sprengen wollte“, erklärte er ohne erkennbares Mitgefühl.
„Dann bin ich also eine Berührte?“, fragte Aska zweifelnd.
„Nein“, lachte er bitter. „Du bist etwas ganz anderes. Etwas wie dich hat es nicht gegeben seit hunderten von Jahren. Stell dir die Götter wie ein helles Licht vor, das in eine Kammer eingesperrt ist. Die Sanktore stehen draußen auf dem dunklen Korridor und werfen einen Blick durch das Schlüsselloch, doch sie können das Ausmaß des Lichtes nur erahnen. Den Berührten ist es gestattet, die Tür einen Spalt breit zu öffnen, doch auch sie dürfen den Raum niemals betreten. Du jedoch, Aska, stehst mitten in diesem Raum, mitten im Licht. Du bist eine lebende Scherbe, verstehst du?“
Nein, sie verstand kein einziges Wort.
„Du bist ein Scherbenkind, Aska“, erklärte er ruhig.
Was immer er da trank, es schien die Wogen in seinem Inneren zu glätten, und Aska war dankbar dafür.
„Du bist wie eine Linse aus Fleisch, durch die das Licht der Götter strahlt. Einer Göttin, um genau zu sein.“
Hochverehrter Kanzler Rowynn,
ich hoffe inständig, dieses Sendschreiben erreicht Euch bei guter Gesundheit. Zugleich möchte ich Euch mein tiefes Bedauern darüber ausdrücken, dass ich so lange dem Hofe ferngeblieben bin. Wenn ich mich recht entsinne, sind es nun beinahe sechs Jahre, seit ich Euch und Eure Familie zuletzt sah. Alwyn, Euer Jüngster, war damals gerade erst den Windeln entwachsen, und nun, wenn er auch nur das Geringste von Eurer Kraft in sich trägt, wird er wohl bereits mit dem Holzschwert üben.
Natürlich ist es überwiegend die Pflicht, die mich vom höfischen Treiben fernhält, doch ich muss gestehen, dass ich mich umso lieber hinter dieser Pflicht verstecke, je mehr der Weggefährten von einst die letzte Fahrt antreten. Kaum noch ein bekanntes Gesicht bei Hofe, kaum noch einer, der des Vergangenen gedenkt. Die Alten entsinnen sich nicht mehr oder versuchen zu vergessen. Und die Jungen schreiben ihre eigene Geschichte.
Es erfüllt mich stets mit Bedauern, feststellen zu müssen, dass ich selbst langsam zu Geschichte werde. Dass die Dinge, die mir des Nachts so klar vor Augen stehen, wenn mir Träume und Erinnerungen den Schlaf rauben, mit der Zeit zu Wörtern verkommen, die zwischen staubigen Buchdeckeln langsam in Vergessenheit geraten.
Umso überraschter war ich natürlich, als mich vor zwölf Monaten Euer Brief und Eure Bitte erreichten. Ich befand mich zu jener Zeit oben in Kaz Durval und leitete archäologische Ausgrabungen, wie Ihr Euch sicher erinnert. Wir hatten gerade erst den Kartenraum entdeckt, und Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass ich alle Hände voll zu tun hatte. Es ist eine Schande, dass die Arbeiten dort mittlerweile eingestellt wurden. Es gibt noch so vieles, das wir von den Ersten lernen könnten, mein Freund!
Erinnert Ihr Euch noch der ersten Jahre nach dem Großen Brand? Bücher wurden damals gehandelt wie Gold. Die Schreiberlinge konnten sich kaum retten vor Aufträgen. Heute klammert sich niemand mehr an das alte Wissen. Erzähltes wurde zu Geschichte, genau wie die Erzähler selbst, und nunmehr wird Geschichte zu Legende. Zu Märchen, die brave Eltern im Schein der Kerzen ihren Kindern erzählen, bevor sie schlafen gehen.
Ihr tut dies nicht, könnte ich mir vorstellen. Ihr erinnert Euch noch, wie wenige echte Helden es damals wirklich gab, und wie wenige Taten es wert waren, besungen zu werden. Das wenige an Wahrheit wurde mit Blut fortgewaschen, und unsere Kinder könnten nie wieder schlafen, wenn wir ihnen erzählen würden, was sich zu jener Zeit wirklich zugetragen hatte.
Ich gestehe, dass ich bis ins Mark gespalten bin, wenn ich meinen eigenen Jungen ansehe. Er ist mittlerweile verheiratet, und im letzten Sommer ist er selbst Vater geworden. Ich bin nun Großvater, könnt Ihr Euch das vorstellen? Und wenn ich an den warmen Abenden im Garten oder in den kalten Winternächten am Kamin bei ihnen sitze, denke ich bisweilen, wie unsinnig mein Bestreben ist. Die Welt hat Recht, wir sollten vergessen, anstatt zu versuchen, uns zu erinnern. Wir sollten die letzten Bücher verbrennen, die letzten Lieder verbieten, bis sich der Schlaf auch auf die letzten Erinnerungen gelegt hat.
Doch wie sollten wir diejenigen, die nach uns kommen, dann vor unseren eigenen Fehlern schützen? Was können wir ihnen hinterlassen außer Legenden und einem schlechten Gewissen? Wie schützen wir unsere Kinder am besten vor unserer eigenen Torheit, Markess? Erinnerung oder Vergessen? Bisweilen, in besonders einsamen Stunden, ertappe ich mich dabei, wie ich noch immer bete. Und dann überkommt mich jedes Mal tiefe Traurigkeit, wenn ich mich erinnere, dass niemand mehr da ist, der zuhört.
Verzeiht meine trübsinnigen Gedanken, mein Freund. Ich befürchte, die Erfüllung Eurer Bitte hat mich doch mehr Kraft gekostet, als ich mir bislang selbst einzugestehen bereit war. Damals, als ich Euren Brief zum ersten Mal las, steckte noch wesentlich mehr Idealismus in mir. Ich ließ Schaufel und Pinsel fallen, um den Bericht anzufertigen, den Ihr anbei finden werdet und der hoffentlich Eure offenen Fragen nach den Geschehnissen beantworten wird. Ich habe mich bemüht, nicht nur mein eigenes Wissen niederzuschreiben, sondern jede Quelle zu nutzen, die mir noch verblieben ist. Für die historischen Fakten verbürge ich mich selbstverständlich. Doch trotz aller Akribie basieren einige Teile des Berichtes – hauptsächlich diejenigen, die sich mit dem Warum befassen – auf Vermutungen, auf Gerüchten und Hörensagen.
Ich muss Euch warnen, Markess. Was Ihr als nüchternen Tatsachenbericht angefordert habt, ist mir wohl über die Monate entglitten. Tatsachen und Wahrheit, mein Freund, sind nicht dasselbe. Und obwohl Ihr klar das Erstere erbeten habt, konnte ich nicht anders, als Euch Letzteres zukommen zu lassen. Da Ihr mit Eurer Bitte jedoch an mich herangetreten seid und an keinen anderen, darf ich annehmen, dass Ihr diese Eventualität bereits berücksichtigt hattet, als Ihr Euren Brief verfasstet.
Verzeiht bitte auch, wenn ich Eure eigene Rolle inmitten der Begebenheiten weit weniger romantisiere als die jungen Burschen hinter den Mauern dessen, was sie heute Akademien nennen. Ich weiß, dass Ihr Euren Platz in der Geschichte kennt und dass es Euch kaum schwerfallen dürfte, diesen Teil der Wahrheit zu akzeptieren.
Was den Rest anbelangt, musste ich jedoch weit tiefer graben, als Ihr es eigentlich verlangt hattet. Viele der Zusammenhänge wurden mir erst bewusst, während ich nach und nach das Bild zusammenfügte, und viele der kleineren Details stellten sich erst bei näherer Untersuchung als so bedeutsam heraus, dass ich sie Euch nicht vorenthalten konnte. Die Wahrheit ist, dass am Ende die Details weit wichtiger sind als das Gesamtbild, denn sie sind es, die das Warum erklären. Und sie sind letzten Endes auch der Grund, warum ich noch immer bete, obwohl niemand mehr zuzuhören scheint.
Mein Bericht geht daher zurück bis zum ersten Tag des Monats des Morgensterns, dem Ilwaton, dem Tag nach der Tränenschlacht, in der die Nordgrenze fiel. Ich werde Euch nicht erneut mit Korrekturen zu den sogenannten historischen Aufzeichnungen über die Schlacht um Kor Drakar langweilen; entsprechende Vermerke konntet Ihr bereits meinem letzten Bericht entnehmen. Dennoch knüpfen die relevanten Begebenheiten, die den Ereignissen, die Euch interessieren dürften, zugrunde liegen, so nahtlos an jenen Tag an, dass es kaum ein Zufall sein dürfte.
Mein Bericht beginnt jedoch nicht in den brennenden Überresten der Eisernen Stadt, nicht einmal innerhalb der Grenzen Westammars, und auch nicht mit großen Namen. Mein Bericht beginnt stattdessen mit einem jungen Mädchen, auf einem Schiff irgendwo inmitten des Namenlosen Meeres …
Das Namenlose Meer
Aska blinzelte verschlafen in das grelle Sonnenlicht, das sie auf dem Deck der „Sturmkrähe“ in Empfang nahm. Sie hatte geschlafen, nur die Götter wussten, wie lang, doch sie fühlte sich kein bisschen erholt. Sie war in der Dunkelheit unter Deck zu sich gekommen, mit steifen Gliedern und zum Bersten voller Blase. Ihr Kopf fühlte sich von den scharfkantigen Träumen und Erinnerungen an, als wäre er mit zerstoßenem Glas gefüllt, und vom Schlingern des Bodens drehte sich ihr der Magen um. Sie war dem Stimmengewirr gefolgt, bis sie schließlich die Treppe gefunden hatte, und nun stach ihr das Licht des Tages so gleißend in die Augen, dass sie sich am liebsten übergeben wollte.
„Obedt!“, herrschte sie ein Mann an, der sich mit nacktem Oberkörper und einem kleinen Fass auf der muskulösen Schulter an ihr vorbeidrängte.
Sie erschrak und stammelte lediglich: „Verzeihung!“
Ein anderer Mann, der sich gerade an der Takelage zu schaffen machte, drehte sich zu dem Fassträger um.
„Dar Kinnen warde nit herden, Janne!“, lachte er schallend.
„Win skard op den Ammari. Op beyden!“, brummte der Kerl mit dem Fass ungehalten und spuckte unflätig aus.
„Sie sprechen die Stimme des Scherbenvolkes nicht“, hörte sie eine gequälte Stimme zu ihrer Rechten. „Und ich verstehe genug Imerisch, als dass ich wirklich wissen wollte, was er gerade gesagt hat.“
Aska sah hinüber zu der niedrigen Reling, und dort, unweit des Aufganges zur Brücke des Schiffes, lehnte der schwarzgekleidete Mann, den Kopf über das Meer gebeugt, sodass Aska sein Gesicht nicht sehen konnte. Sie tat einen Schritt auf ihn zu, und noch während sie den säuerlichen Geruch bemerkte, der die dunkle Gestalt umwehte wie die böse Verkehrung eines Parfüms, übergab der Mann sich keuchend und so heftig, als wolle er seine Innereien in die Gischt spucken.
„Boros sei mir gnädig“, hauchte er. „Ich hasse das Meer!“
Aska hielt höflich Abstand und gab ihm einen Augenblick, sich nach der Attacke wieder zu sammeln. Währenddessen warf sie einen Blick über das Deck und die Mannschaft, die es bevölkerte. Die „Sturmkrähe“ war kein besonders großes Schiff, eine zweimastige, pummelige Brigg, und ihre Mannschaft schien ein zusammengewürfelter Haufen von Matrosen aus allen möglichen Ländern zu sein. Aska sah hauptsächlich weißhäutige Imerier, aber dazwischen auch einen riesigen, muskelbepackten Dowari, ein paar bronzefarbene Ashuri und das Blond der Westlinge.
Als der Atem des Mannes sich langsam wieder beruhigte, trat sie entschlossen einen weiteren Schritt auf ihn zu.
„Ich hatte noch keine Gelegenheit, Euch zu danken“, sagte sie und meinte es ernst, obwohl ihr der Sinn gerade kaum nach Höflichkeit stand. Ihr eigener Magen rebellierte beim Geruch des Erbrochenen, doch sie war fest entschlossen, zunächst dem Anstand Raum zu geben, bevor sie sich zweifellos zu dem Mann gesellen würde.
„Bei den Göttern!“, murmelte der Mann und drehte sich langsam um.
Aska erschrak so heftig, dass sie beinahe das Gleichgewicht verloren hätte, als sie das Gesicht des Mannes erblickte.
„Deine Dankbarkeit interessiert mich einen Rattenschiss!“, fuhr er sie böse an, und die Narben auf seiner Haut gerieten in Bewegung wie Steine bei einem Erdrutsch.
Sein Gesicht war vollkommen verbrannt, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Für einen Moment glaubte Aska, in einen bösen Spiegel zu blicken, doch verglichen mit ihm war ihr eigenes Gesicht unter der Maske wohlgeformt. Über seiner rechten Wange klaffte ein riesiges Loch und legte die darunterliegenden Zähne frei, sodass es den Anschein hatte, er würde sie angrinsen. Von seiner Nase waren lediglich noch ruinenhafte Reste übrig. Etwas unsagbar Grauenhaftes musste diesem Mann zugestoßen sein, und einzig seine Augen schienen davon verschont geblieben zu sein.
Seine Augen. Die Augen eines Raubvogels. Eines Falken! Die Erinnerung traf sie so heftig, so grell und brutal, dass sie für einen Augenblick nicht atmen konnte. In diesem Augenblick lag der Duft von süßen Fladen über dem salzigen Geruch des Meeres, und Derrens Flötenspiel klang in den Wellen, die sacht gegen den Bug schlugen. Irgendwo hinter ihr sang ein Scherenschleifer ein fröhliches Lied, und Aska konnte das Kreischen des Metalls auf dem Schleifstein hören.
„Ihr“, presste sie mühsam hervor, „Ihr ward dort!“
Seine Augen durchbohrten sie förmlich, und ein unsagbarer Hass lag darin, der offensichtlich ihr galt.
„Zu meinem endlosen Bedauern, ja“, knurrte er, und die Zähne unter dem rotgeränderten Loch in seiner Wange mahlten unablässig.
Sie spürte, dass etwas Boshaftes von ihm ausging, ihn umwehte wie zuvor der säuerliche Gestank seines Mageninhaltes, doch für den Moment spürte sie keine Angst, nur abgrundtiefe Fassungslosigkeit.
„Dann seid Ihr ein Reiter Brymkasts?“, fragte sie aufgeregt, denn sie konnte noch immer nicht glauben, dass dies der Mann sein sollte, den sie vor einem halben Leben in Raunwald gesehen hatte, kurz bevor das Feuer ausgebrochen war.
„Das war ich einmal“, entgegnete er knapp, und plötzlich lag tiefe Traurigkeit in seiner Stimme.
Sie spürte, dass er noch mehr dazu zu sagen hatte, hielt es jedoch für unangebracht, ihn zu drängen. Er war aufgewühlt, und angesichts seines Zustandes war das auch kaum verwunderlich. Stattdessen wechselte sie das Thema, stellte ihm die eine von den tausend Fragen, die ihr am meisten auf der Seele brannte.
„Ihr kanntet meinen Vater?“, fragte sie leise.
Er starrte sie an, mehr noch durch sie hindurch, als wenn hinter ihr die Vergangenheit Gestalt angenommen hätte.
„Ja, ich kannte Dargo“, entgegnete er einsilbig.
Erinnerungsschwangere Stille legte sich zwischen sie, so dicht, dass selbst das Lärmen der Matrosen in weite Ferne zu rücken schien. Er schlug die Augen nieder, bevor er traurig fortfuhr.
„Er war ein tapferer Mann. Vielleicht der tapferste, den ich je gekannt habe. Er hat Opfer gebracht, zu denen ich selbst nie bereit war.“
Die grauen Augen inmitten des zerstörten Gesichtes hefteten sich erneut an Askas Blick, doch diesmal lag kein Zorn darin, nur Bedauern, bodenlos und tiefschwarz.
„Er hat sie für dich gebracht, Kind!“
Sie erinnerte sich an die letzten Momente, an die schrecklichen Wunden in Vaters Gesicht, bevor er sie verlassen hatte. Sie erinnerte sich an das Feuer, das sich durch ihre Kleider, durch ihre Haut und ihr Fleisch bis in ihre Seele gefressen hatte. Doch am deutlichsten erinnerte sie sich an die Liebe in Vaters letztem Blick, an das warme Gefühl, das seine Opferbereitschaft in ihr ausgelöst hatte, dort, inmitten von Leid und Tod und Zerstörung.
„Er ist für mich gestorben“, sprach sie laut den einen Gedanken aus, von dem sie plötzlich erfüllt war, und dicke Tränen liefen unter ihrer Maske herab.
„Mehr noch“, entgegnete Falkenauge. „Er hat für dich gelebt!“
Dann sah er sie an, sah mitten in sie hinein, bevor er weitersprach.
„Aber dein Vater war er nicht.“
Etwas in Askas Seele zerriss mit einem lauten, kreischenden Geräusch, das nur sie selbst hören konnte. Bevor sie es bemerkte, sank sie auf die Knie, während ihr Innerstes langsam auseinanderbrach wie eine Eisscholle im Sommer. Die Frau, die sie erst viel später hätte werden sollen, stand auf der einen Seite dieser Kluft, und diese Frau wusste, dass der fremde Mann keinen Grund hatte, sie anzulügen. Mehr noch, sie spürte, dass er die Wahrheit sagte. Doch das Kind in ihr, das jenseits des breiter werdenden Abgrunds langsam in die Dunkelheit trieb, das Kind, das seinen Vater verehrt, seinen Bruder geliebt hatte, wollte davon nichts wissen.
„Ihr lügt!“, brüllte sie ihm trotzig in sein hässliches Gesicht.
Er durchmaß den Raum zwischen ihm und ihr mit wenigen Schritten und ohrfeigte sie so hart, dass sie auf den feuchten Planken des Decks zu Boden ging. Ihre Maske flog davon, schlitterte über das harte Holz und blieb einen Meter vor ihr liegen. Panisch kroch sie zu dem weißen Ding hinüber, das nun ihr Gesicht geworden war, und während sich glühender Schmerz auf ihrer Wange ausbreitete, streifte sie die Maske erneut über und richtete in aller Eile ihre Kapuze, bevor sie sich angsterfüllt wieder zu ihm umdrehte. Er kniete direkt vor ihr und funkelte sie hasserfüllt an.
„Hör gut zu, Mädchen!“, fauchte er, und seine grauenhafte Fratze war so nah an ihrem Gesicht, dass sie seinen sauren Atem riechen konnte. „Dargo war nicht dein Vater, Halyanna nicht deine Mutter, Thomas nicht dein Bruder. Dein ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Du bist nichts weiter als eine Missgeburt, eine üble Laune der Götter, und wäre ich nicht an meinen Eid gebunden, würde ich dir selbst die Kehle durchschneiden für das, was du bist!“
Zorn stieg in ihr hoch, breitete sich vom Zentrum ihres Herzens aus wie eine Flamme, die sich langsam durch sie hindurchfraß. Die Angst, die sie vor diesem Ungeheuer empfand, wurde von ihrem Zorn erfasst und binnen eines Augenblicks zu weißer Asche verbrannt.
„Und was bin ich?“, krochen die Worte wie giftige Schlangen über ihre Lippen.
„Du bist ein Monster“, erwiderte er kalt und deutete auf ihre Hände.
Sie sah an sich herab auf ihre Handflächen, und kleine, blassblaue Flämmchen tanzten darauf, bildeten langsam orangefarbene Ränder. Und noch während sie erschrocken die Fäuste ballte, um das Feuer zu ersticken, hob er sie schroff auf die Beine und zog sie unsanft mit sich.
Als sie kurz darauf in der Dunkelheit der Mannschaftsquartiere saß und ihn dabei beobachtete, wie er irgendeine scheußlich stinkende Flüssigkeit in sich hineinkippte, fühlte sie rein gar nichts mehr. Das Kind in ihr war verstummt, die Frau verschwunden, und übrig blieb nur der gähnende Abgrund in ihrer zerbrochenen Seele.
„Ich kann dir nicht sagen, was du bist“, fing er mit schwerer Zunge an zu erzählen. „Dargo hat es mir einmal erklärt, doch das ist fast neun Jahre her. Doch ich bin es ihm wohl schuldig, es wenigstens zu versuchen. Du weißt sicher, dass es Menschen gibt, die die Kräfte der Scherben kontrollieren können, oder?“
„Ihr meint die Priester?“, fragte sie vorsichtig, um ihn nicht erneut zu verärgern.
Doch für den Augenblick schien seine Wut verraucht zu sein, begraben unter Trauer und Selbstmitleid.
„Ganz recht, die achtmal verfluchten Priester“, antwortete er lallend. „Doch selbst die Besten unter ihnen benötigen oft viele Jahre der Übung, bis sie auch nur einen kleinen Teil der Macht der Götter für sich beanspruchen können. Die meisten dienen dem Glauben ihr Leben lang, ohne jemals von den Scherben berührt zu werden. Andere benötigen Drogen oder Wut oder Meditation, um ihre Magie wirken zu können.“
Sie nickte kurz. Das alles hatte sie noch von Bramquists endlosen Stunden der Scherbenlehre behalten.
„Einige wenige allerdings werden mit der Gabe geboren“, fuhr er fort. „Sie können Feuer, Wasser oder Stein manipulieren, ohne es jemals erlernt haben zu müssen. Meistens erreichen diese Berührten hohe Ränge in den Scherbenorden. Viele Archonen waren und sind Berührte. Dein Freund Callo Varras gilt ebenfalls als einer von ihnen.“
„Wer?“, unterbrach sie verständnislos.
„Das Ungeheuer, das dich in der Stadt in Stücke sprengen wollte“, erklärte er ohne erkennbares Mitgefühl.
„Dann bin ich also eine Berührte?“, fragte Aska zweifelnd.
„Nein“, lachte er bitter. „Du bist etwas ganz anderes. Etwas wie dich hat es nicht gegeben seit hunderten von Jahren. Stell dir die Götter wie ein helles Licht vor, das in eine Kammer eingesperrt ist. Die Sanktore stehen draußen auf dem dunklen Korridor und werfen einen Blick durch das Schlüsselloch, doch sie können das Ausmaß des Lichtes nur erahnen. Den Berührten ist es gestattet, die Tür einen Spalt breit zu öffnen, doch auch sie dürfen den Raum niemals betreten. Du jedoch, Aska, stehst mitten in diesem Raum, mitten im Licht. Du bist eine lebende Scherbe, verstehst du?“
Nein, sie verstand kein einziges Wort.
„Du bist ein Scherbenkind, Aska“, erklärte er ruhig.
Was immer er da trank, es schien die Wogen in seinem Inneren zu glätten, und Aska war dankbar dafür.
„Du bist wie eine Linse aus Fleisch, durch die das Licht der Götter strahlt. Einer Göttin, um genau zu sein.“