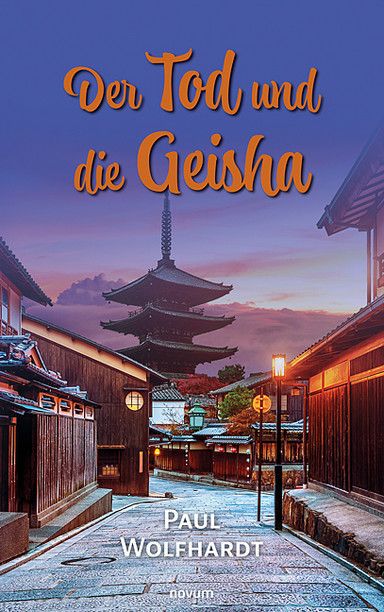Der Tod und die Geisha
Paul Wolfhardt
EUR 20,90
EUR 16,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 386
ISBN: 978-3-99131-633-6
Erscheinungsdatum: 28.11.2022
Ein Österreicher nimmt in Japan an einem Karate-Turnier teil. Er verliebt sich in eine ebenso reizende wie mysteriöse Frau, doch wird er aus ihr nicht klug. Meint sie es ehrlich, oder treibt sie mit ihm ein doppeltes Spiel? Exotisch, stimmungsvoll, einzigartig.
Sie wohnte in einem relativ großen Haus am Stadtrand. Erst dachte ich, es wäre das Haus ihrer Eltern. Doch als ich ankam und sie mich bat, im Vorraum die Schuhe auszuziehen, erfuhr ich, dass sie hier nur mit ihrer Katze lebte. Ich fand es seltsam, dass sie ein ganzes Haus für sich allein brauchte, fragte aber nicht weiter.
Später erzählte sie mir, wie sie zu dem Haus gekommen war. Bis zu ihrem Studienbeginn hätte sie noch bei ihren Eltern draußen auf dem Land gewohnt. Im ersten Semester wäre sie zur Uni hin und zurück täglich drei Stunden mit dem Zug gefahren. Doch weil ihr das lästig wurde, hätte sie sich nach einer kleinen Wohnung in der Stadt umgesehen. Was sie fand, war kein Studentenheim, aber laut Mietvertrag wurden im Haus die Apartments ausschließlich an junge Frauen vermietet, und der Großteil davon waren Studentinnen. Mit der Zeit erwies sich die Unterkunft, die eigentlich nur aus einem Zimmer mit Kochnische bestand, dazu ein Bad mit Klo, jedoch als unpraktisch. Und als sich die Sache mit dem Haus hier ergab, zog sie dorthin um. Ein Makler hatte es ihr vermittelt, und sie hätte der günstigen Miete wegen sofort zugegriffen.
Von außen sah das Haus japanisch aus, doch innen war es eher europäisch eingerichtet. Als sie mich ins Wohnzimmer führte, fiel mir eine große Anzahl von Blumenbuketts auf, die in Vasen am Tisch, auf einer Kommode, einige sogar am Boden standen und einen schwülen Duft verbreiteten. Auf meine Frage, was das bedeutete, sagte sie, dass sie vorgestern ihren Geburtstag feierte – den wievielten, wollte sie nicht verraten –, und die Blumen hätte sie aus diesem Anlass bekommen. Davon hatte ich nichts gewusst, daher war es mir unangenehm, ohne Geschenk dazustehen. Ich hatte nur einen kleinen Strauß mitgebracht, und der nahm sich, obwohl sie sich überschwänglich dafür bedankte, neben den teuren Buketts sehr mickrig aus.
Bisher hatte ich sie außer in der Klinik immer sehr schick gekleidet gesehen, doch an dem Tag sah sie fast bäuerlich aus. Sie war kaum geschminkt, trug keinen Schmuck und hatte ihr Haar mit einer Schleife im Nacken gebunden. Dazu hatte sie eine Latzhose an, und als sie sich zum Kochen bereit machte, streifte sie sich noch eine unförmige Schürze über, wie sie biedere japanische Hausfrauen tragen.
Als sie mich in ihre Küche führte, roch es dort schon sehr gut, weil sie einen Teil der Speisen bereits vorbereitet hatte. Ich fragte, ob ich mich nützlich machen könnte, sie aber sagte, nein, ich solle es mir in der Sitzecke bequem machen. Und sie stellte mir einen Teller mit Samosa als Vorspeise und ein Glas Lassi hin. Danach machte sie sich allein an die Arbeit.
Ihre Küche war vorzüglich ausgestattet. Es gab alles, was man zum Kochen brauchte. Aber man sah den Küchengeräten an, dass sie kaum benutzt wurden. Sie glänzten alle blitzblank, standen zum Teil nur wie zu Dekorationszwecken auf den Regalen. Yuka sagte selbst, dass sie höchst selten koche. Wenn, dann nur für Gäste, für sich so gut wie gar nie. Gleichzeitig wollte sie mir weismachen, dass Kochen ihr Hobby wäre und sie nur aus Zeitmangel nicht öfter dazukäme.
Heute sollte es ihre Lieblingsspeise, indisches Curry, geben. Denn sie liebte, wie sie sagte, die indische Küche und überhaupt alles, was mit Indien zu tun hätte. Während ich noch daran dachte, ob es mit ihrer Lieblingsspeise wohl eine ähnliche Bewandtnis hatte wie mit ihrem Lieblingslokal, erzählte sie mir, dass sie noch nie in Indien gewesen wäre, jedoch die Absicht hätte, irgendwann einmal hinzureisen. Und während sie weiter am Herd hantierte, erwähnte sie, was sie dort alles sehen wollte: Mumbai, Dehli, Kolkatta, das Taj Mahal und so weiter. Es lag ein Bildband von Indien auf dem Tisch, den ich auf ihre Aufforderung hin durchblätterte. Inzwischen verstärkten sich die indischen Düfte, und als ich fragte, was für Gewürze das wären, zählte sie auf: Kardamom, Garam Masala, Turmeric, Tamarind, Zimt und Ingwer. Dann stellte sie verschiedene Schüsseln auf den Tisch und nötigte mich, von jeder zu kosten. Sie hatte sich selbst übertroffen, jede Soße hatte ihren eigenen, charakteristischen Geschmack, keine war zu scharf, und eine, bestehend aus Yoghurt mit Früchten und Nüssen, schmeckte sogar süß. An Fleisch gab es Lamm, als Beilage Reis, aber auch Nan. Das indische Brot hatte sie, wie sie sagte, nach einem einfachen Rezept selbst gebacken.
Nachdem alles fertig auf dem Tisch stand, legte sie die Schürze wieder ab und setzte sich zu mir. Nur für uns zwei hatte sie eine Menge Aufwand getrieben, sie musste den ganzen Vormittag damit in der Küche beschäftigt gewesen sein. Als ich ihr für die Mühe danken wollte, wehrte sie ab und sagte, sie hätte es nur aus Freude am Kochen getan. Und wie schon im Restaurant aß sie selbst wenig, freute sich aber, dass ich mit Appetit zugriff.
Dann kam sie wieder auf Indien zu sprechen, und als ich sagte, dass eine Reise nach Indien auch mein Traum wäre, schlug sie vor, gemeinsam mit mir hinzufahren. Das erstaunte mich nicht wenig. Meinte sie das ernst? Damals im Restaurant hatte sie davon gesprochen, mir hier in der Umgebung verschiedene Sehenswürdigkeiten zu zeigen, bisher war aber nichts daraus geworden. Offenbar schmiedete sie gern Pläne, die sie danach wieder einschlafen ließ. Es war wohl besser, ihre Träume nicht mitzuträumen, wenn ich mir spätere Enttäuschungen ersparen wollte.
Dieser Gedanke bedrückte mich ein wenig, denn ich hätte gerne mit ihr eine Reise gemacht. Prompt riss der Gesprächsfaden, und die heitere Stimmung war wieder mal dahin. Sie stand auf, um Tschai zu machen. Ich wollte ihr helfen, das Geschirr abzutragen, aber sie ließ es nicht zu. Ich sollte in ihrem Zimmer warten, bis der Tee fertig wäre. Doch obwohl ich davon ausging, dass sie das Wohnzimmer meinte, führte sie mich in ihr Schlafzimmer und ließ mich dort allein.
Erst dachte ich mir nichts dabei, doch als ich mich genauer umsah, fühlte ich mich wie vor den Kopf geschlagen. An den Wänden hingen Bilder im indischen Stil mit Kamasutra-Motiven. Die hätten mich zwar nicht gestört, aber das Zimmer wurde dominiert von einem riesigen Doppelbett, das gut und gern die Hälfte des Raums einnahm. Kissen und Bettdecken waren mit grünen Blattmotiven dekoriert, und über dem Kopfende hing ein künstliches Blätterdach wie ein Baldachin. Darin steckten kleine Leuchtdioden, mit denen man das Zimmer quasi weihnachtlich illuminieren konnte. Das war kein Schlafzimmer einer allein lebenden Frau, sondern ein gestyltes Boudoir.
Sie hatte mich auf einem schmalen Sofa platziert, das am Fußende mit der Rückenlehne zum Bett stand. Davor ein kleines Tischchen und an der Wand gegenüber ein Flachbildschirm. Der stand auf einem Schränkchen, darin ein DVD-Player und einige DVDs. Konnte ich mich schon beim Anblick des Bettes eines unguten Eindrucks nicht erwehren, war ich nun noch mehr schockiert, als ich sah, was für DVDs da im Schrank lagen. Wo war ich da nur reingeraten? Das Herz begann mir bis zum Hals zu schlagen, und ich hatte ein Gefühl, als wäre ich in eine Falle gegangen. Warum hatte sie mich in dieses Zimmer geführt? Wir hätten doch genauso gut ins Wohnzimmer gehen oder, noch besser, in der Küche bleiben können. Und je länger ich dort saß, desto unwohler wurde mir zumute.
Endlich kam sie mit dem Tschai, und bei der Gelegenheit schlich auch ihre Katze mit herein. Von der hatte ich bisher nur gehört, sie aber noch nicht gesehen. Nun sprang sie mir auf den Schoß, als wäre sie Herrenbesuch gewöhnt. Yuka stellte derweil das kleine Tablett mit zwei Tassen auf das Tischchen vor mir. Anstatt sich jedoch neben mich zu setzen, kniete sie sich seitlich neben dem Sofa auf ein kleines Stück Fell hin und servierte mir in dieser Stellung den Tee.
Danach sah sie mich fragend an. Mir lag zwar eine Frage auf den Lippen, doch hinderte mich etwas daran, ich wusste selbst nicht was, sie auszusprechen. Sie hielt aber meinem Blick stand und wandte sich nicht ab wie sonst. Sie sah mir in die Augen, als versuchte sie, darin zu lesen. Jetzt erst fiel mir auf, dass auch sie angespannt und nervös wirkte. Bisher hatte sie sich bei unseren Begegnungen immer sehr locker gegeben. Es war ihr anzumerken, dass sie Routine darin hatte, Gespräche zu lenken, Themen aufs Tapet zu bringen oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Kam etwas auf, was die gute Laune zu stören drohte, ging sie geschickt mit einem Scherz darüber hinweg. Doch diesmal schien es so, als forderte sie mich indirekt auf, das zu äußern, was mir auf der Zunge lag.
Ich war unschlüssig, wie ich mich verhalten sollte und fühlte mich wie in einer Zwickmühle. Ich fand die richtigen Worte nicht, weil mich die Furcht, sie zu beleidigen, zurückhielt, zu sagen, was ich dachte. Spräche ich es aus, könnte es das Ende unserer Freundschaft bedeuten. Um Zeit zu gewinnen, nippte ich am Tschai. Doch dabei verbrannte ich mir die Zunge. Das Gefäß war aus dickem Ton, sodass die Hitze von außen nicht zu spüren war. Doch der Tee darin war nicht nur heiß, er hatte auch eine Schärfe, die einen bitteren Nachgeschmack hinterließ. Als ich die Tasse absetzte, sagte ich zu ihr: „Very hot!“
In dem Augenblick schien sich die angespannte Situation zwischen uns ein wenig zu lösen. Sie wandte den Blick ab von mir und nahm nun selbst einen Schluck. Doch als sie ihre Tasse zurück aufs Tischchen stellte, bemerkte ich, dass ihre Hände zitterten. Sie wirkte nach wie vor wie auf die Folter gespannt, und ich sah ein, dass es mir nichts nützen würde, weiter den Stummen zu spielen. Sie erwartete eine Stellungnahme von mir, um die Lage zu klären. Nun wusste ich auch, warum sie mich eingeladen und ausgerechnet in dieses Zimmer geführt hatte. Sie wollte nichts vor mir verbergen, wollte so offen zu mir sein, wie sie nur konnte, ohne die Sache beim Namen zu nennen. Doch wie sollte ich darauf reagieren, ohne Gefahr zu laufen, alles zwischen uns zu zerstören?
Je länger das Schweigen zwischen uns andauerte, desto schwieriger wurde es zu brechen. Ich beugte mich vor, um meine Tasse auf das Tischchen zu stellen. In dem Moment sprang die Katze herunter von meinem Schoß, streckte sich am Boden und machte einen Katzenbuckel. Daraufhin begann Yuka, ihr den Rücken zu streicheln. Doch während sie ihr das Fell kraulte, wartete sie immer noch darauf, dass ich endlich den Mund aufmachte.
Die Situation wurde so unangenehm, dass ich nichts anderes zu tun wusste, als aufzustehen und zu sagen, ich müsse jetzt gehen. Ich wunderte mich dabei selbst über meine Stimme, die wie eingerostet klang. „Ach so?“, antwortete sie nur, ohne von ihrer Katze abzulassen. Ich stand verlegen da und zögerte, ob ich allein vorangehen sollte. Schließlich machte sich aber die Katze davon, Yuka erhob sich und begleitete mich hinaus.
Während ich in meine Schuhe schlüpfte, stand sie hinter mir und hielt meine Jacke. Die ganze Zeit fiel zwischen uns kein Wort. Als ich das Haus verließ, sagte sie leise „Sayonara“ und ich „Auf Wiedersehen“. Mir war aber bewusst: Wenn es kein Abschied auf immer werden sollte, durfte ich ihr die Antwort, auf die sie wartete, nicht schuldig bleiben.
Ich hätte ihr gern angedeutet, was mich so plötzlich gedrängt hatte, zu gehen. Mir war klar, dass mein Verhalten schroff auf sie wirken musste. Es sah so aus, als wollte ich davonlaufen, aber ich konnte in der Situation nicht anders. Mein Kopf war wie blockiert, ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Es ging mir nicht darum, mit ihr zu brechen, aber ich musste das alles erst verdauen und ins Reine kommen mit meinen widerstreitenden Gefühlen und Gedanken. Vorher war es mir unmöglich, mit ihr über das, was sie mir heute zu verstehen gegeben hatte, zu sprechen.
Wie sie meinen abrupten Aufbruch auffasste, konnte ich nicht einschätzen, ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Mir fiel nur auf, dass ihre Miene beim Abschied wie versteinert war, nichts vom maskenhaften Lächeln, das sie sonst immer zur Schau trug. Wir hatten es beide vermieden, uns in die Augen zu sehen. Doch nachdem ich ihr Haus verlassen hatte, spürte ich, dass sich ihre Blicke wie Speere in meinen Rücken bohrten.
Das Gefühl, ihr waidwund entronnen zu sein, ließ mich auf dem ganzen Heimweg nicht los. Ich wusste, dass meine Flucht keine Lösung war, denn das, wovor ich zu fliehen versuchte, würde mich früher oder später einholen. Trotzdem oder gerade deswegen irrte ich wie ein gehetztes Wild durch die Straßen. Da ich mit dem Kopf ganz woanders war, fand ich die Busstation nicht. Es war, als hielte mich etwas gegen meinen Willen hier fest. Schließlich gab ich die Suche auf und beschloss, zu Fuß nach Haus zu gehen. Es war zwar ein weiter Weg, aber da es erst früher Nachmittag war, würde ich noch vor dem Abend heimkommen. Ich hoffte, dass der Sturm in meinem Inneren bis dahin abgeklungen wäre, denn vor dem kalten leeren Zimmer, das mich daheim erwartete, graute mir schon jetzt.
Irgendwie hatte ich bereits so eine Ahnung gehabt. So oft, wenn ich sie angerufen hatte, war ihr Handy besetzt oder nur die Mailbox zu erreichen. Hinterließ ich ihr eine Nachricht, rief sie erst Tage später zurück. Fragte ich nach dem Grund, redete sie sich heraus, dass sie sehr beschäftigt wäre. Warum sie aber so viel zu tun hatte, sagte sie nie. Sie sprach immer davon, dass sie neben ihrem Studium noch einen Job hätte. Was für eine Tätigkeit das war, hatte sie mir nicht genauer erklärt, aber es machte mich immer argwöhnisch, wenn sie wieder mal erwähnte, dass ihr ein Bekannter dies zu Gefallen getan hatte und ein anderer jenes. Sie ließ sich nie entlocken, woher sie die Männer kannte und in welchem Verhältnis sie zu ihnen stand. Es lag aber der Verdacht nahe, dass die Gefälligkeiten, die ihr die erwiesen, etwa der Makler oder der Autohändler, auf Gegenseitigkeit beruhten. Und ich konnte mir nun auch denken, von wem die Blumenbuketts waren. Sie hatte es mir schonend beibringen wollen, trotzdem fühlte ich mich von ihr gedemütigt und verletzt.
Ich sah nur drei mögliche Auswege aus dem Dilemma.
Erstens: mich wieder aufs Karate zu konzentrieren und ihr fortan aus dem Weg zu gehen.
Zweitens: Japan zu verlassen und die Chance auf die Revanche beim Turnier aufzugeben.
Drittens: Hierzubleiben und …
Eine Stimme in mir klagte sie an: Lass die Finger von ihr, an so eine streift man am besten nicht an. Die macht jeden, der sich mit ihr einlässt, nur unglücklich.
Eine andere Stimme verteidigte sie: Nein, so ist sie nicht! Gib ihr die Chance, das zu beweisen. Und kommt es ganz dick, kannst du immer noch die Reißleine ziehen!
Innerlich zerrissen, kam ich zu keiner Entscheidung. Aber obwohl ich sie bisher noch nicht einmal geküsst hatte, fühlte ich mich dennoch emotional bereits so stark an sie gebunden, dass ich wusste, es würde mir sehr schwerfallen, mich von ihr zu trennen.
Frierend lief ich durch die kalten, windigen Straßen und geriet in ein Schneegestöber. Ich verfluchte mich selbst, in welch verfahrene Lage ich mich gebracht hatte. Weil ich mich hier nicht auskannte, lief ich ständig in die Irre. Egal, wo ich abbog, immer hatte ich das Gefühl, dass ich hier falsch wäre und nur im Kreis ginge. Und auf einmal – ich wusste selbst nicht, wie – war ich wieder da, von wo ich ausgegangen war und wohin es mich die ganze Zeit zurückgezogen hatte. Ich stand vor ihrer Tür, und nach einigem Zögern läutete ich. Als ich drinnen ihre Schritte hörte, klopfte mir das Herz zum Zerspringen.
***
Sie arbeitete schon seit Jahren in einer Bar, die „Bourbon“ hieß, aber nur Insidern bekannt war, weil sie ganz versteckt in der Innenstadt lag und nicht einmal ein Türschild hatte. Der Klub galt als exklusiv. Mama-san, die Betreiberin, legte Wert auf ein gehobenes Publikum mit Geld und Manieren, darum verließ sie sich nur auf Mundpropaganda. Wer einmal ins „Bourbon“ kam, sollte zufrieden wieder gehen und beim nächsten Mal Freunde aus seinen Kreisen mitbringen. Laufkundschaft lehnte sie hingegen ab.
Die Aufgabe, dass sich die Gäste wohlfühlten, fiel jedoch in erster Linie den Hostessen zu, daher war Mama-san bei deren Auswahl immer sehr darauf bedacht, attraktive und niveauvolle Mädchen zu finden. Sie verlangte keine makellose Schönheit, aber jede sollte einen persönlichen Reiz und eine gewisse Ausstrahlung mitbringen. Und man sagte ihr nach, dass sie einen guten Blick dafür hatte, welche Mädchen ihren Gästen gefielen, und sie nahm nur solche, die in ihr Anforderungsprofil passten.
Ab und zu engagierte sie auch Studentinnen. Für die war eine Tätigkeit in der Bar insofern interessant, als sie dort besser verdienten als in jedem anderen Job. Und als Mary in der Bar anfing, ließ ihr Mama-san sogar mehr Freiheiten als den übrigen Mädchen, weil sie nicht nur hübsch und klug, sondern mit ihrer leicht spröden und dennoch liebenswürdigen Art bei den Gästen außerordentlich beliebt war.
Mary hatte ursprünglich vor, nur ein paar Monate, längstens ein Jahr, zu bleiben, um ihr Taschengeld aufzubessern, bis sie ihr Studium abgeschlossen hätte. Mama-san, die Marys Potenzial erkannte, tat jedoch alles dafür, sie länger zu halten. Und ihre Rechnung ging auf. Da sich ihr Studium immer mehr in die Länge zog, weil sie mit ihrer Abschlussarbeit nicht fertig wurde, verweigerte ihr der Vater weitere Zahlungen. Und indem ihr Mama-san aus der Not half, gelang es ihr, Mary fest an sich zu binden. Am Ende gab sie die Uni ganz auf und arbeitete fast allabendlich in der Bar, denn selbst mit beendetem Studium hätte sie kaum einen besser bezahlten Job gefunden.
Verführt vom scheinbar leicht verdienten Geld, hatte sie sich selbst betrogen. Sie war mit diesem Job in ein Milieu geraten, aus dem es umso schwieriger wurde, auszusteigen, je länger man dabei war. Mama-san hatte genug Erfahrung, um das vorauszusehen. Ohne abgeschlossenes Studium wäre Mary nur übrig geblieben, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das hätten auch ihre Eltern, die nach wie vor keine Ahnung von der Tätigkeit ihrer Tochter in der Bar hatten, am liebsten gesehen. Immer wieder versuchten sie, ihr „eine gute Partie“ einzureden, doch davon wollte Mary nichts wissen. Auf Dauer konnte sie zwar die Augen vor den Schattenseiten ihres Berufs nicht verschließen, aber sie hatte das Gefühl, wenn sie heiratete, nur um versorgt zu werden, würde sie sich genauso verkaufen wie in der Bar.
***
Als Yuka öffnete, sah sie mich verwundert an. Mit meinem Kommen hatte sie wohl nicht gerechnet. Im nächsten Augenblick lagen wir uns aber schon in den Armen. Sie lehnte ihren Kopf an meine Brust, ich schmiegte meine Wange an ihr duftendes Haar. Danach lud sie mich ein, abzulegen und führte mich wie am Vormittag in die Küche. Es roch immer noch ein wenig nach Curry, denn sie hatte zwar schon aufgeräumt und das Geschirr abgewaschen, aber einige Schüsseln standen noch auf dem Tisch.
Wir setzten uns, um über alles zu sprechen, was bisher zwischen uns unausgesprochen geblieben war. Sie hatte keine Scheu mehr, mir offen die Wahrheit zu sagen und alle meine Fragen zu beantworten. Die Zeit verging dabei wie im Nu, wir merkten erst, als es draußen schon dunkelte, wie spät es geworden war. Eigentlich hätte sie schon zur Arbeit gehen sollen. Sie deutete auch an, sich langsam fertig machen zu müssen, blieb aber dennoch bei mir sitzen. Wir konnten uns einfach nicht voneinander losreißen, und am Ende rief sie in der Bar an, um zu sagen, dass sie heute wegen einer Erkältung nicht kommen könne. Man schien ihr das zwar nicht ganz zu glauben, doch letztlich kam sie mit ihrer Ausrede durch. Und zu mir sagte sie, als sie ihr Handy abstellte, dass sie den heutigen Abend nur mit mir verbringen wolle.
Erst dachte ich, wir würden zusammen hier bleiben, doch sie schlug vor, aufs Land zu fahren. Meinen Einwand, dass das Wetter kalt und unfreundlich wäre, ließ sie nicht gelten, denn die Schneeschauer hatten wieder aufgehört. Sie zog sich rasch etwas anderes an, dann brachen wir auf. Wir fuhren mit ihrem Wagen hinaus aus der Stadt Richtung Berge, doch wollte sie mir nicht verraten, wohin, sie sagte nur, sie wolle mich überraschen.
Die Straße führte zwischen kahlen, braunen, vereinzelt auch schneebedeckten Feldern dahin. Nach einer Weile bogen wir von der Landstraße ab, erst ging es durch ein Waldstück, dann in zahlreichen Windungen eine schmale Bergstraße hinauf. Und nach einer scharfen Biegung öffnete sich plötzlich eine Aussicht ins Tal. Angeblich zeigte sich hier bei schönem Wetter ein herrliches Bergpanorama, doch obwohl es etwas aufgeklart hatte, hingen immer noch Wolken am Himmel, und von den Bergen ringsum war nicht viel zu sehen. Yuka hielt auf einem Parkplatz, der sich neben einem alten Holzgebäude befand, und sagte, hier gäbe es ein Lokal, das ein Geheimtipp wäre, berühmt für seine lokale Küche, seinen Sake und seinen Ausblick in die Berge.
Wir stiegen aus. Da sonst kein anderes Fahrzeug hier parkte, schienen wir die einzigen Gäste zu sein. Beim Hauseingang öffnete Yuka die Schiebetür und rief laut: „Gomen kudasai!“ Von drinnen kam keine Antwort, vor uns lag nur ein dunkel schweigender Flur. Yuka wurde unsicher, ob das Lokal heute überhaupt geöffnet hätte. Erst auf ihr nochmaliges Rufen hin erschien eine Frau, wie sich herausstellte, handelte es sich um die Wirtin. Mit dem Hinweis, heute wäre Ruhetag, wollte sie uns abweisen. Als Yuka jedoch ihren Namen nannte, wurde sie freundlicher. Sie erinnerte sich, dass Yukas Eltern früher in der Nähe ein Ryokan betrieben hatten, sie kannte Yuka daher noch als Kind. Und plötzlich war vom Ruhetag keine Rede mehr. Die Wirtin bat uns reinzukommen, entschuldigte sich aber, dass sie uns heute Abend nur etwas Einfaches zu essen anbieten könne. Wir erklärten uns damit einverstanden, und so ging sie voraus und führte uns in den Gastraum. Der wirkte urig und rustikal, am Boden alte, gelb gewordene Tatami-Strohmatten, an den Wänden vergilbte Tapeten. Auch alte Bilder hingen da, und in der Mitte des Raumes stützte ein schwarzer Holzbalken die Decke. Das Zimmer war ungeheizt, und ein eigentümlicher Geruch lag in der Luft, doch durch die Fensterfront bot sich ein wunderschöner Blick. Die Wolken begannen sich zu verziehen, und es zeigte sich ein Teil der schneebedeckten Bergkette im aufgehenden Mondlicht.
Wir ließen uns an dem Tisch nieder, den uns die Wirtin anwies. Yuka kniete sich vornehm auf das Sitzpolster, ich aber setzte mich im Türkensitz hin und lehnte mich mit dem Rücken an den Holzbalken. Wir hatten unsere Jacken abgelegt, doch die Kälte im Raum war ein wenig ungemütlich, noch dazu in Socken, holte man sich hier schnell kalte Füße. Die Wirtin schob einen Heizstrahler an unseren Tisch, und als Yuka heißen Sake bestellte, hatte ich nichts dagegen.
Nachdem sie uns allein gelassen hatte, kam die Wirtin nach einer Weile wieder mit Sake in einem vasenförmigen Kännchen und zwei kleinen Trinkschalen. Obwohl Yuka wusste, dass ich normalerweise keinen Alkohol trank und sie selbst, weil sie mit dem Auto da war, auch nichts trinken hätte dürfen, schenkte sie uns beiden ein. Dann stießen wir mit den kleinen Schälchen an. Ich nahm einen Schluck. Der Sake schmeckte herb, aber wärmte angenehm von innen, und so dachte ich mir, das bisschen würde schon nicht schaden.
Die Wirtin besprach mit Yuka, was sie uns zu essen anbieten könnte und ging dann wieder hinaus. Wir tranken weiter, und es dauerte gar nicht lange, bis die ersten Speisen kamen. Mehrmals ging die Schiebetür auf, und die Wirtin brachte uns nach und nach Misosuppe, Tofu, Nudeln und Tempura.
Yuka sah mir beim Essen zu, rührte selbst aber kaum etwas an, kostete nur ab und zu. Sie trank außer der ersten Schale auch keinen Sake mehr, sondern nur noch Tee, aber mir schenkte sie immer wieder ein. Der Sake trank sich leicht, und nun schon einmal auf den Geschmack gekommen und meinem Prinzip untreu geworden, trank ich weiter, sodass das Kännchen bald leer war.
Später erzählte sie mir, wie sie zu dem Haus gekommen war. Bis zu ihrem Studienbeginn hätte sie noch bei ihren Eltern draußen auf dem Land gewohnt. Im ersten Semester wäre sie zur Uni hin und zurück täglich drei Stunden mit dem Zug gefahren. Doch weil ihr das lästig wurde, hätte sie sich nach einer kleinen Wohnung in der Stadt umgesehen. Was sie fand, war kein Studentenheim, aber laut Mietvertrag wurden im Haus die Apartments ausschließlich an junge Frauen vermietet, und der Großteil davon waren Studentinnen. Mit der Zeit erwies sich die Unterkunft, die eigentlich nur aus einem Zimmer mit Kochnische bestand, dazu ein Bad mit Klo, jedoch als unpraktisch. Und als sich die Sache mit dem Haus hier ergab, zog sie dorthin um. Ein Makler hatte es ihr vermittelt, und sie hätte der günstigen Miete wegen sofort zugegriffen.
Von außen sah das Haus japanisch aus, doch innen war es eher europäisch eingerichtet. Als sie mich ins Wohnzimmer führte, fiel mir eine große Anzahl von Blumenbuketts auf, die in Vasen am Tisch, auf einer Kommode, einige sogar am Boden standen und einen schwülen Duft verbreiteten. Auf meine Frage, was das bedeutete, sagte sie, dass sie vorgestern ihren Geburtstag feierte – den wievielten, wollte sie nicht verraten –, und die Blumen hätte sie aus diesem Anlass bekommen. Davon hatte ich nichts gewusst, daher war es mir unangenehm, ohne Geschenk dazustehen. Ich hatte nur einen kleinen Strauß mitgebracht, und der nahm sich, obwohl sie sich überschwänglich dafür bedankte, neben den teuren Buketts sehr mickrig aus.
Bisher hatte ich sie außer in der Klinik immer sehr schick gekleidet gesehen, doch an dem Tag sah sie fast bäuerlich aus. Sie war kaum geschminkt, trug keinen Schmuck und hatte ihr Haar mit einer Schleife im Nacken gebunden. Dazu hatte sie eine Latzhose an, und als sie sich zum Kochen bereit machte, streifte sie sich noch eine unförmige Schürze über, wie sie biedere japanische Hausfrauen tragen.
Als sie mich in ihre Küche führte, roch es dort schon sehr gut, weil sie einen Teil der Speisen bereits vorbereitet hatte. Ich fragte, ob ich mich nützlich machen könnte, sie aber sagte, nein, ich solle es mir in der Sitzecke bequem machen. Und sie stellte mir einen Teller mit Samosa als Vorspeise und ein Glas Lassi hin. Danach machte sie sich allein an die Arbeit.
Ihre Küche war vorzüglich ausgestattet. Es gab alles, was man zum Kochen brauchte. Aber man sah den Küchengeräten an, dass sie kaum benutzt wurden. Sie glänzten alle blitzblank, standen zum Teil nur wie zu Dekorationszwecken auf den Regalen. Yuka sagte selbst, dass sie höchst selten koche. Wenn, dann nur für Gäste, für sich so gut wie gar nie. Gleichzeitig wollte sie mir weismachen, dass Kochen ihr Hobby wäre und sie nur aus Zeitmangel nicht öfter dazukäme.
Heute sollte es ihre Lieblingsspeise, indisches Curry, geben. Denn sie liebte, wie sie sagte, die indische Küche und überhaupt alles, was mit Indien zu tun hätte. Während ich noch daran dachte, ob es mit ihrer Lieblingsspeise wohl eine ähnliche Bewandtnis hatte wie mit ihrem Lieblingslokal, erzählte sie mir, dass sie noch nie in Indien gewesen wäre, jedoch die Absicht hätte, irgendwann einmal hinzureisen. Und während sie weiter am Herd hantierte, erwähnte sie, was sie dort alles sehen wollte: Mumbai, Dehli, Kolkatta, das Taj Mahal und so weiter. Es lag ein Bildband von Indien auf dem Tisch, den ich auf ihre Aufforderung hin durchblätterte. Inzwischen verstärkten sich die indischen Düfte, und als ich fragte, was für Gewürze das wären, zählte sie auf: Kardamom, Garam Masala, Turmeric, Tamarind, Zimt und Ingwer. Dann stellte sie verschiedene Schüsseln auf den Tisch und nötigte mich, von jeder zu kosten. Sie hatte sich selbst übertroffen, jede Soße hatte ihren eigenen, charakteristischen Geschmack, keine war zu scharf, und eine, bestehend aus Yoghurt mit Früchten und Nüssen, schmeckte sogar süß. An Fleisch gab es Lamm, als Beilage Reis, aber auch Nan. Das indische Brot hatte sie, wie sie sagte, nach einem einfachen Rezept selbst gebacken.
Nachdem alles fertig auf dem Tisch stand, legte sie die Schürze wieder ab und setzte sich zu mir. Nur für uns zwei hatte sie eine Menge Aufwand getrieben, sie musste den ganzen Vormittag damit in der Küche beschäftigt gewesen sein. Als ich ihr für die Mühe danken wollte, wehrte sie ab und sagte, sie hätte es nur aus Freude am Kochen getan. Und wie schon im Restaurant aß sie selbst wenig, freute sich aber, dass ich mit Appetit zugriff.
Dann kam sie wieder auf Indien zu sprechen, und als ich sagte, dass eine Reise nach Indien auch mein Traum wäre, schlug sie vor, gemeinsam mit mir hinzufahren. Das erstaunte mich nicht wenig. Meinte sie das ernst? Damals im Restaurant hatte sie davon gesprochen, mir hier in der Umgebung verschiedene Sehenswürdigkeiten zu zeigen, bisher war aber nichts daraus geworden. Offenbar schmiedete sie gern Pläne, die sie danach wieder einschlafen ließ. Es war wohl besser, ihre Träume nicht mitzuträumen, wenn ich mir spätere Enttäuschungen ersparen wollte.
Dieser Gedanke bedrückte mich ein wenig, denn ich hätte gerne mit ihr eine Reise gemacht. Prompt riss der Gesprächsfaden, und die heitere Stimmung war wieder mal dahin. Sie stand auf, um Tschai zu machen. Ich wollte ihr helfen, das Geschirr abzutragen, aber sie ließ es nicht zu. Ich sollte in ihrem Zimmer warten, bis der Tee fertig wäre. Doch obwohl ich davon ausging, dass sie das Wohnzimmer meinte, führte sie mich in ihr Schlafzimmer und ließ mich dort allein.
Erst dachte ich mir nichts dabei, doch als ich mich genauer umsah, fühlte ich mich wie vor den Kopf geschlagen. An den Wänden hingen Bilder im indischen Stil mit Kamasutra-Motiven. Die hätten mich zwar nicht gestört, aber das Zimmer wurde dominiert von einem riesigen Doppelbett, das gut und gern die Hälfte des Raums einnahm. Kissen und Bettdecken waren mit grünen Blattmotiven dekoriert, und über dem Kopfende hing ein künstliches Blätterdach wie ein Baldachin. Darin steckten kleine Leuchtdioden, mit denen man das Zimmer quasi weihnachtlich illuminieren konnte. Das war kein Schlafzimmer einer allein lebenden Frau, sondern ein gestyltes Boudoir.
Sie hatte mich auf einem schmalen Sofa platziert, das am Fußende mit der Rückenlehne zum Bett stand. Davor ein kleines Tischchen und an der Wand gegenüber ein Flachbildschirm. Der stand auf einem Schränkchen, darin ein DVD-Player und einige DVDs. Konnte ich mich schon beim Anblick des Bettes eines unguten Eindrucks nicht erwehren, war ich nun noch mehr schockiert, als ich sah, was für DVDs da im Schrank lagen. Wo war ich da nur reingeraten? Das Herz begann mir bis zum Hals zu schlagen, und ich hatte ein Gefühl, als wäre ich in eine Falle gegangen. Warum hatte sie mich in dieses Zimmer geführt? Wir hätten doch genauso gut ins Wohnzimmer gehen oder, noch besser, in der Küche bleiben können. Und je länger ich dort saß, desto unwohler wurde mir zumute.
Endlich kam sie mit dem Tschai, und bei der Gelegenheit schlich auch ihre Katze mit herein. Von der hatte ich bisher nur gehört, sie aber noch nicht gesehen. Nun sprang sie mir auf den Schoß, als wäre sie Herrenbesuch gewöhnt. Yuka stellte derweil das kleine Tablett mit zwei Tassen auf das Tischchen vor mir. Anstatt sich jedoch neben mich zu setzen, kniete sie sich seitlich neben dem Sofa auf ein kleines Stück Fell hin und servierte mir in dieser Stellung den Tee.
Danach sah sie mich fragend an. Mir lag zwar eine Frage auf den Lippen, doch hinderte mich etwas daran, ich wusste selbst nicht was, sie auszusprechen. Sie hielt aber meinem Blick stand und wandte sich nicht ab wie sonst. Sie sah mir in die Augen, als versuchte sie, darin zu lesen. Jetzt erst fiel mir auf, dass auch sie angespannt und nervös wirkte. Bisher hatte sie sich bei unseren Begegnungen immer sehr locker gegeben. Es war ihr anzumerken, dass sie Routine darin hatte, Gespräche zu lenken, Themen aufs Tapet zu bringen oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Kam etwas auf, was die gute Laune zu stören drohte, ging sie geschickt mit einem Scherz darüber hinweg. Doch diesmal schien es so, als forderte sie mich indirekt auf, das zu äußern, was mir auf der Zunge lag.
Ich war unschlüssig, wie ich mich verhalten sollte und fühlte mich wie in einer Zwickmühle. Ich fand die richtigen Worte nicht, weil mich die Furcht, sie zu beleidigen, zurückhielt, zu sagen, was ich dachte. Spräche ich es aus, könnte es das Ende unserer Freundschaft bedeuten. Um Zeit zu gewinnen, nippte ich am Tschai. Doch dabei verbrannte ich mir die Zunge. Das Gefäß war aus dickem Ton, sodass die Hitze von außen nicht zu spüren war. Doch der Tee darin war nicht nur heiß, er hatte auch eine Schärfe, die einen bitteren Nachgeschmack hinterließ. Als ich die Tasse absetzte, sagte ich zu ihr: „Very hot!“
In dem Augenblick schien sich die angespannte Situation zwischen uns ein wenig zu lösen. Sie wandte den Blick ab von mir und nahm nun selbst einen Schluck. Doch als sie ihre Tasse zurück aufs Tischchen stellte, bemerkte ich, dass ihre Hände zitterten. Sie wirkte nach wie vor wie auf die Folter gespannt, und ich sah ein, dass es mir nichts nützen würde, weiter den Stummen zu spielen. Sie erwartete eine Stellungnahme von mir, um die Lage zu klären. Nun wusste ich auch, warum sie mich eingeladen und ausgerechnet in dieses Zimmer geführt hatte. Sie wollte nichts vor mir verbergen, wollte so offen zu mir sein, wie sie nur konnte, ohne die Sache beim Namen zu nennen. Doch wie sollte ich darauf reagieren, ohne Gefahr zu laufen, alles zwischen uns zu zerstören?
Je länger das Schweigen zwischen uns andauerte, desto schwieriger wurde es zu brechen. Ich beugte mich vor, um meine Tasse auf das Tischchen zu stellen. In dem Moment sprang die Katze herunter von meinem Schoß, streckte sich am Boden und machte einen Katzenbuckel. Daraufhin begann Yuka, ihr den Rücken zu streicheln. Doch während sie ihr das Fell kraulte, wartete sie immer noch darauf, dass ich endlich den Mund aufmachte.
Die Situation wurde so unangenehm, dass ich nichts anderes zu tun wusste, als aufzustehen und zu sagen, ich müsse jetzt gehen. Ich wunderte mich dabei selbst über meine Stimme, die wie eingerostet klang. „Ach so?“, antwortete sie nur, ohne von ihrer Katze abzulassen. Ich stand verlegen da und zögerte, ob ich allein vorangehen sollte. Schließlich machte sich aber die Katze davon, Yuka erhob sich und begleitete mich hinaus.
Während ich in meine Schuhe schlüpfte, stand sie hinter mir und hielt meine Jacke. Die ganze Zeit fiel zwischen uns kein Wort. Als ich das Haus verließ, sagte sie leise „Sayonara“ und ich „Auf Wiedersehen“. Mir war aber bewusst: Wenn es kein Abschied auf immer werden sollte, durfte ich ihr die Antwort, auf die sie wartete, nicht schuldig bleiben.
Ich hätte ihr gern angedeutet, was mich so plötzlich gedrängt hatte, zu gehen. Mir war klar, dass mein Verhalten schroff auf sie wirken musste. Es sah so aus, als wollte ich davonlaufen, aber ich konnte in der Situation nicht anders. Mein Kopf war wie blockiert, ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Es ging mir nicht darum, mit ihr zu brechen, aber ich musste das alles erst verdauen und ins Reine kommen mit meinen widerstreitenden Gefühlen und Gedanken. Vorher war es mir unmöglich, mit ihr über das, was sie mir heute zu verstehen gegeben hatte, zu sprechen.
Wie sie meinen abrupten Aufbruch auffasste, konnte ich nicht einschätzen, ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Mir fiel nur auf, dass ihre Miene beim Abschied wie versteinert war, nichts vom maskenhaften Lächeln, das sie sonst immer zur Schau trug. Wir hatten es beide vermieden, uns in die Augen zu sehen. Doch nachdem ich ihr Haus verlassen hatte, spürte ich, dass sich ihre Blicke wie Speere in meinen Rücken bohrten.
Das Gefühl, ihr waidwund entronnen zu sein, ließ mich auf dem ganzen Heimweg nicht los. Ich wusste, dass meine Flucht keine Lösung war, denn das, wovor ich zu fliehen versuchte, würde mich früher oder später einholen. Trotzdem oder gerade deswegen irrte ich wie ein gehetztes Wild durch die Straßen. Da ich mit dem Kopf ganz woanders war, fand ich die Busstation nicht. Es war, als hielte mich etwas gegen meinen Willen hier fest. Schließlich gab ich die Suche auf und beschloss, zu Fuß nach Haus zu gehen. Es war zwar ein weiter Weg, aber da es erst früher Nachmittag war, würde ich noch vor dem Abend heimkommen. Ich hoffte, dass der Sturm in meinem Inneren bis dahin abgeklungen wäre, denn vor dem kalten leeren Zimmer, das mich daheim erwartete, graute mir schon jetzt.
Irgendwie hatte ich bereits so eine Ahnung gehabt. So oft, wenn ich sie angerufen hatte, war ihr Handy besetzt oder nur die Mailbox zu erreichen. Hinterließ ich ihr eine Nachricht, rief sie erst Tage später zurück. Fragte ich nach dem Grund, redete sie sich heraus, dass sie sehr beschäftigt wäre. Warum sie aber so viel zu tun hatte, sagte sie nie. Sie sprach immer davon, dass sie neben ihrem Studium noch einen Job hätte. Was für eine Tätigkeit das war, hatte sie mir nicht genauer erklärt, aber es machte mich immer argwöhnisch, wenn sie wieder mal erwähnte, dass ihr ein Bekannter dies zu Gefallen getan hatte und ein anderer jenes. Sie ließ sich nie entlocken, woher sie die Männer kannte und in welchem Verhältnis sie zu ihnen stand. Es lag aber der Verdacht nahe, dass die Gefälligkeiten, die ihr die erwiesen, etwa der Makler oder der Autohändler, auf Gegenseitigkeit beruhten. Und ich konnte mir nun auch denken, von wem die Blumenbuketts waren. Sie hatte es mir schonend beibringen wollen, trotzdem fühlte ich mich von ihr gedemütigt und verletzt.
Ich sah nur drei mögliche Auswege aus dem Dilemma.
Erstens: mich wieder aufs Karate zu konzentrieren und ihr fortan aus dem Weg zu gehen.
Zweitens: Japan zu verlassen und die Chance auf die Revanche beim Turnier aufzugeben.
Drittens: Hierzubleiben und …
Eine Stimme in mir klagte sie an: Lass die Finger von ihr, an so eine streift man am besten nicht an. Die macht jeden, der sich mit ihr einlässt, nur unglücklich.
Eine andere Stimme verteidigte sie: Nein, so ist sie nicht! Gib ihr die Chance, das zu beweisen. Und kommt es ganz dick, kannst du immer noch die Reißleine ziehen!
Innerlich zerrissen, kam ich zu keiner Entscheidung. Aber obwohl ich sie bisher noch nicht einmal geküsst hatte, fühlte ich mich dennoch emotional bereits so stark an sie gebunden, dass ich wusste, es würde mir sehr schwerfallen, mich von ihr zu trennen.
Frierend lief ich durch die kalten, windigen Straßen und geriet in ein Schneegestöber. Ich verfluchte mich selbst, in welch verfahrene Lage ich mich gebracht hatte. Weil ich mich hier nicht auskannte, lief ich ständig in die Irre. Egal, wo ich abbog, immer hatte ich das Gefühl, dass ich hier falsch wäre und nur im Kreis ginge. Und auf einmal – ich wusste selbst nicht, wie – war ich wieder da, von wo ich ausgegangen war und wohin es mich die ganze Zeit zurückgezogen hatte. Ich stand vor ihrer Tür, und nach einigem Zögern läutete ich. Als ich drinnen ihre Schritte hörte, klopfte mir das Herz zum Zerspringen.
***
Sie arbeitete schon seit Jahren in einer Bar, die „Bourbon“ hieß, aber nur Insidern bekannt war, weil sie ganz versteckt in der Innenstadt lag und nicht einmal ein Türschild hatte. Der Klub galt als exklusiv. Mama-san, die Betreiberin, legte Wert auf ein gehobenes Publikum mit Geld und Manieren, darum verließ sie sich nur auf Mundpropaganda. Wer einmal ins „Bourbon“ kam, sollte zufrieden wieder gehen und beim nächsten Mal Freunde aus seinen Kreisen mitbringen. Laufkundschaft lehnte sie hingegen ab.
Die Aufgabe, dass sich die Gäste wohlfühlten, fiel jedoch in erster Linie den Hostessen zu, daher war Mama-san bei deren Auswahl immer sehr darauf bedacht, attraktive und niveauvolle Mädchen zu finden. Sie verlangte keine makellose Schönheit, aber jede sollte einen persönlichen Reiz und eine gewisse Ausstrahlung mitbringen. Und man sagte ihr nach, dass sie einen guten Blick dafür hatte, welche Mädchen ihren Gästen gefielen, und sie nahm nur solche, die in ihr Anforderungsprofil passten.
Ab und zu engagierte sie auch Studentinnen. Für die war eine Tätigkeit in der Bar insofern interessant, als sie dort besser verdienten als in jedem anderen Job. Und als Mary in der Bar anfing, ließ ihr Mama-san sogar mehr Freiheiten als den übrigen Mädchen, weil sie nicht nur hübsch und klug, sondern mit ihrer leicht spröden und dennoch liebenswürdigen Art bei den Gästen außerordentlich beliebt war.
Mary hatte ursprünglich vor, nur ein paar Monate, längstens ein Jahr, zu bleiben, um ihr Taschengeld aufzubessern, bis sie ihr Studium abgeschlossen hätte. Mama-san, die Marys Potenzial erkannte, tat jedoch alles dafür, sie länger zu halten. Und ihre Rechnung ging auf. Da sich ihr Studium immer mehr in die Länge zog, weil sie mit ihrer Abschlussarbeit nicht fertig wurde, verweigerte ihr der Vater weitere Zahlungen. Und indem ihr Mama-san aus der Not half, gelang es ihr, Mary fest an sich zu binden. Am Ende gab sie die Uni ganz auf und arbeitete fast allabendlich in der Bar, denn selbst mit beendetem Studium hätte sie kaum einen besser bezahlten Job gefunden.
Verführt vom scheinbar leicht verdienten Geld, hatte sie sich selbst betrogen. Sie war mit diesem Job in ein Milieu geraten, aus dem es umso schwieriger wurde, auszusteigen, je länger man dabei war. Mama-san hatte genug Erfahrung, um das vorauszusehen. Ohne abgeschlossenes Studium wäre Mary nur übrig geblieben, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das hätten auch ihre Eltern, die nach wie vor keine Ahnung von der Tätigkeit ihrer Tochter in der Bar hatten, am liebsten gesehen. Immer wieder versuchten sie, ihr „eine gute Partie“ einzureden, doch davon wollte Mary nichts wissen. Auf Dauer konnte sie zwar die Augen vor den Schattenseiten ihres Berufs nicht verschließen, aber sie hatte das Gefühl, wenn sie heiratete, nur um versorgt zu werden, würde sie sich genauso verkaufen wie in der Bar.
***
Als Yuka öffnete, sah sie mich verwundert an. Mit meinem Kommen hatte sie wohl nicht gerechnet. Im nächsten Augenblick lagen wir uns aber schon in den Armen. Sie lehnte ihren Kopf an meine Brust, ich schmiegte meine Wange an ihr duftendes Haar. Danach lud sie mich ein, abzulegen und führte mich wie am Vormittag in die Küche. Es roch immer noch ein wenig nach Curry, denn sie hatte zwar schon aufgeräumt und das Geschirr abgewaschen, aber einige Schüsseln standen noch auf dem Tisch.
Wir setzten uns, um über alles zu sprechen, was bisher zwischen uns unausgesprochen geblieben war. Sie hatte keine Scheu mehr, mir offen die Wahrheit zu sagen und alle meine Fragen zu beantworten. Die Zeit verging dabei wie im Nu, wir merkten erst, als es draußen schon dunkelte, wie spät es geworden war. Eigentlich hätte sie schon zur Arbeit gehen sollen. Sie deutete auch an, sich langsam fertig machen zu müssen, blieb aber dennoch bei mir sitzen. Wir konnten uns einfach nicht voneinander losreißen, und am Ende rief sie in der Bar an, um zu sagen, dass sie heute wegen einer Erkältung nicht kommen könne. Man schien ihr das zwar nicht ganz zu glauben, doch letztlich kam sie mit ihrer Ausrede durch. Und zu mir sagte sie, als sie ihr Handy abstellte, dass sie den heutigen Abend nur mit mir verbringen wolle.
Erst dachte ich, wir würden zusammen hier bleiben, doch sie schlug vor, aufs Land zu fahren. Meinen Einwand, dass das Wetter kalt und unfreundlich wäre, ließ sie nicht gelten, denn die Schneeschauer hatten wieder aufgehört. Sie zog sich rasch etwas anderes an, dann brachen wir auf. Wir fuhren mit ihrem Wagen hinaus aus der Stadt Richtung Berge, doch wollte sie mir nicht verraten, wohin, sie sagte nur, sie wolle mich überraschen.
Die Straße führte zwischen kahlen, braunen, vereinzelt auch schneebedeckten Feldern dahin. Nach einer Weile bogen wir von der Landstraße ab, erst ging es durch ein Waldstück, dann in zahlreichen Windungen eine schmale Bergstraße hinauf. Und nach einer scharfen Biegung öffnete sich plötzlich eine Aussicht ins Tal. Angeblich zeigte sich hier bei schönem Wetter ein herrliches Bergpanorama, doch obwohl es etwas aufgeklart hatte, hingen immer noch Wolken am Himmel, und von den Bergen ringsum war nicht viel zu sehen. Yuka hielt auf einem Parkplatz, der sich neben einem alten Holzgebäude befand, und sagte, hier gäbe es ein Lokal, das ein Geheimtipp wäre, berühmt für seine lokale Küche, seinen Sake und seinen Ausblick in die Berge.
Wir stiegen aus. Da sonst kein anderes Fahrzeug hier parkte, schienen wir die einzigen Gäste zu sein. Beim Hauseingang öffnete Yuka die Schiebetür und rief laut: „Gomen kudasai!“ Von drinnen kam keine Antwort, vor uns lag nur ein dunkel schweigender Flur. Yuka wurde unsicher, ob das Lokal heute überhaupt geöffnet hätte. Erst auf ihr nochmaliges Rufen hin erschien eine Frau, wie sich herausstellte, handelte es sich um die Wirtin. Mit dem Hinweis, heute wäre Ruhetag, wollte sie uns abweisen. Als Yuka jedoch ihren Namen nannte, wurde sie freundlicher. Sie erinnerte sich, dass Yukas Eltern früher in der Nähe ein Ryokan betrieben hatten, sie kannte Yuka daher noch als Kind. Und plötzlich war vom Ruhetag keine Rede mehr. Die Wirtin bat uns reinzukommen, entschuldigte sich aber, dass sie uns heute Abend nur etwas Einfaches zu essen anbieten könne. Wir erklärten uns damit einverstanden, und so ging sie voraus und führte uns in den Gastraum. Der wirkte urig und rustikal, am Boden alte, gelb gewordene Tatami-Strohmatten, an den Wänden vergilbte Tapeten. Auch alte Bilder hingen da, und in der Mitte des Raumes stützte ein schwarzer Holzbalken die Decke. Das Zimmer war ungeheizt, und ein eigentümlicher Geruch lag in der Luft, doch durch die Fensterfront bot sich ein wunderschöner Blick. Die Wolken begannen sich zu verziehen, und es zeigte sich ein Teil der schneebedeckten Bergkette im aufgehenden Mondlicht.
Wir ließen uns an dem Tisch nieder, den uns die Wirtin anwies. Yuka kniete sich vornehm auf das Sitzpolster, ich aber setzte mich im Türkensitz hin und lehnte mich mit dem Rücken an den Holzbalken. Wir hatten unsere Jacken abgelegt, doch die Kälte im Raum war ein wenig ungemütlich, noch dazu in Socken, holte man sich hier schnell kalte Füße. Die Wirtin schob einen Heizstrahler an unseren Tisch, und als Yuka heißen Sake bestellte, hatte ich nichts dagegen.
Nachdem sie uns allein gelassen hatte, kam die Wirtin nach einer Weile wieder mit Sake in einem vasenförmigen Kännchen und zwei kleinen Trinkschalen. Obwohl Yuka wusste, dass ich normalerweise keinen Alkohol trank und sie selbst, weil sie mit dem Auto da war, auch nichts trinken hätte dürfen, schenkte sie uns beiden ein. Dann stießen wir mit den kleinen Schälchen an. Ich nahm einen Schluck. Der Sake schmeckte herb, aber wärmte angenehm von innen, und so dachte ich mir, das bisschen würde schon nicht schaden.
Die Wirtin besprach mit Yuka, was sie uns zu essen anbieten könnte und ging dann wieder hinaus. Wir tranken weiter, und es dauerte gar nicht lange, bis die ersten Speisen kamen. Mehrmals ging die Schiebetür auf, und die Wirtin brachte uns nach und nach Misosuppe, Tofu, Nudeln und Tempura.
Yuka sah mir beim Essen zu, rührte selbst aber kaum etwas an, kostete nur ab und zu. Sie trank außer der ersten Schale auch keinen Sake mehr, sondern nur noch Tee, aber mir schenkte sie immer wieder ein. Der Sake trank sich leicht, und nun schon einmal auf den Geschmack gekommen und meinem Prinzip untreu geworden, trank ich weiter, sodass das Kännchen bald leer war.