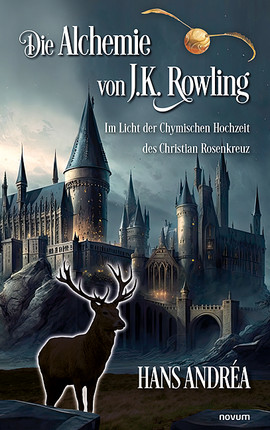Der letzte Brief
Roman
Oskar Szabo
EUR 19,90
EUR 11,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 428
ISBN: 978-3-99064-759-2
Erscheinungsdatum: 18.11.2019
Vorwiegend in Briefform erfährt man von den wechselvollen Erlebnissen der Mitglieder eines problematischen Familienverbandes, den tragischen Ereignissen bis hin zum Freitod einer Seniorin, der viele Fragen aufwirft.
Ein Foto aus Louis’ Familienalbum
Sonntag, es schneite und der Schnee blieb liegen, mindestens 15 Zentimeter hoch, der Wind war stürmisch und die Kälte beißend. An den geplanten Ausflug in die Berge war nicht zu denken, nein, ich nistete mich zu Hause ein, entfachte ein Kaminfeuer und stellte mich auf einen Lesesonntag ein, wie es einige gab in letzter Zeit, denn wir hatten einen strengen Winter, der sich offensichtlich noch nicht verabschiedet hat. Pech für viele, nicht aber für den Bücherwurm, der sich auf weitere ersprießliche Lektüre freut. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich plötzlich die Idee hatte, in meinem Familienalbum zu blättern und was ich darin suchen wollte. Egal, ich stieß unvermutet auf ein Bild, das mich festhielt, ohne erkennbaren Grund, es sei denn … ja, vielleicht! Ich betrachtete es mit Interesse: Ja natürlich, ich erinnere mich sehr wohl an diese Szene …Es war ein Bild aus der Wohnküche eines Ferienhauses, das wir vor vielen, vielen Jahren für eine Woche mieteten, um Winterferien zu verbringen, und zwar zusammen mit der noch jungen Familie eines Cousins, namens Stan, mit Frau und dem erstgeborenen Kind namens Simonetta. Mit dabei waren deren frischgebackene Großmutter, Martina, sowie meine eigene Familie, die damals bereits vierköpfig war. Es war eine gewöhnliche Szene einer gelangweilten Familie: Die noch versammelte Belegschaft nämlich, welche nach dem Frühstück - die Teller waren schon aufgestapelt, die Tassen leer - noch plaudernd am Tisch sitzen geblieben ist, weil, wohl wetterbedingt, keine Eile angesagt war und keiner wusste, was zu unternehmen sich am ehesten noch anbot … im Vordergrund Martina mit rauchender Zigarette, graumelierten Haaren und Brille, vermutlich sprechend, daneben die Mutter meiner Kinder mit der Zweitgeborenen auf dem Schoß und an der Stirnseite des Tisches die ebenfalls frischgebackene Mutter, Stans Frau, mit Simonetta auf den Armen, Letztere höchstens einige Monate alt, schlafend, satt. Auf der anderen Tischseite saß Stan mit meiner ältesten Tochter auf den Knien, die ihren reichlich abgenutzten Bären namens „Schwarzes Bébé“ herzte. Es sieht alles sehr friedlich aus, zufriedene Gesichter allenthalben, ernsthaft indes der Gesichtsausdruck Martinas, die gerade dabei war, irgendetwas ‚ganz richtig zu sagen‘, nicht erinnerlich indes, worum es dabei ging; ‚Eizes‘ - eines ihrer Lieblingswörter - für die Erziehung wohl? Die Familienidylle, so es denn eine war, schien ungetrübt, sicher aber sind damals Bande neu geknüpft worden, die alsdann lange halten sollten, wenngleich nicht in dieser harmonischen Form. Dieser kritische Gedanke schoss mir augenblicklich durch den Kopf, als ich das Bild betrachtete. Weshalb mich gerade dieses Bild - ich war ja der Fotograf und sah die Szene aus derselben Perspektive wie damals - in seinen Bann zog, war mir nicht klar. Es war eine Momentaufnahme, die ich seinerzeit erfrischend fand und nun als Erinnerungsbild an vergangene Zeiten zur Kenntnis nahm, wenngleich ich dabei ein eigenartiges Gefühl hatte, führte ich doch wenige Tage davor mit der nunmehr betagten Martina ein langes Telefongespräch, dessen Inhalt mich wohl noch immer beschäftigte, denn die Zeit zwischen der auf dem Bild festgehaltenen Szene und dem Telefonat, rund dreißig Jahre, hat, vermöge zahlreicher, teils einschneidender Vorfälle, vieles verändert, das der lockeren Atmosphäre auf dem beschriebenen Bild nicht nur widerspricht, sondern geradezu von gegensätzlicher Art ist. Die Familien zerfielen in ihre „Einzelteile“, um es kurz zu sagen, und sorgten immer mal wieder für heiße Köpfe.Es war offenbar kein Zufall, vielleicht sogar ein seherischer Akt, so man sich eine derartige Fähigkeit zubilligen möchte, dass ich mich eingehend mit diesem Bild beschäftigte, der folgende Montag verschaffte Klarheit …
Todesanzeige auf dem Fax
Nach einer schlaflosen Nacht brach der Montag an, ein gewöhnlicher Montag, wie es mindestens deren 52 pro Jahr gibt, wobei nahezu jeder dem vorangehenden wie auch dem nachfolgenden gleicht wie ein Ei dem anderen. Montag also und sonst nichts; Montage sind ohnehin unbeliebt, doch hartnäckig wiederholen sie sich Woche für Woche, als wären sie einem Pendel der Ewigkeit verpflichtet. Nach einem ersprießlichen Wochenende, sei es aktiver oder passiver Natur, meist ziemlich entspannt, stellt man sich unwillkürlich wieder darauf ein, hektische und zuweilen auch aufregende Stunden durchzustehen, auch stets abzuarbeiten, was anfällt, kurzum, sich in der gewohnten Arbeitswelt wieder zurechtzufinden, das Los des Normalbürgers, dessen sich zu entschlagen, nie gelang. Das ist somit der Normalfall und mitunter gelingt es auch auf Anhieb, sich umzustellen, zuweilen braucht man vielleicht einen Moment, um den Unmut über die allzu rasch dahineilende Zeit zu überwinden, den Unmut vielleicht auch, die Muße, durch das Müssen zu ersetzen.Nun, man nimmt es zunächst gelassen hin, betritt das Büro, um sich am Arbeitsplatz niederzulassen, betrachtet etwa mit einem schiefen Blick, vielleicht sogar etwas verdrießlich den Stapel von Papieren, den es zu erledigen gilt, weiß indes, dass kein Weg daran vorbeiführt, und beginnt, zunächst noch im Tempo der Freizeit, wohl gemächlich, dann mit zunehmendem Eifer und speditiv, Stück um Stück zu erledigen. Die Maschine läuft an, tut ihren Dienst, wie jeden Montag und alle weiteren Werktage auch, Gewohnheit und Routine greifen Platz. Doch dieser Montag hatte einen besonderen „Geruch“, war nicht wie sonst, nicht nur, weil er rein zufällig der letzte Tag im kurzen Monat Februar war, sondern weil zudem irgendetwas in der Luft lag, etwas, das nicht auf Anhieb erkennbar war. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut, kaute noch an jenem eigenartigen Telefongespräch herum, das ich am Freitagabend führte, es wollte mir nicht aus dem Kopf gehen, mir schwante Unheil. Nun ja, die liebe Cousine, mit welcher ich zeitlebens einen recht intensiven Kontakt pflegte, ist mittlerweile in die Jahre gekommen und körperlich angeschlagen, lebte allein in ihrem Haus und hatte reichlich Sorgen, derer sie nicht Herr wurde. Sie rief mich an, um mich offiziell über einen ungewöhnlich hässlichen Brief ihres jüngeren Sohnes zu informieren, den sie selbigen Tages erhielt, in Tat und Wahrheit jedoch aus einem ganz anderen Grund, der sich mir nicht unmittelbar erschloss. Sie las ihn nicht in seiner ganzen Länge vor, erläuterte aber - teilweise, wie sich später herausstellen sollte - dessen Inhalt, der wie immer vorwurfsvoll und anklagend, ja teilweise sogar bösartig war, denn das Verhältnis zu ihm war aus bislang unerfindlichen Gründen massiv gestört. Er habe nun, so dessen wichtigste Eröffnung, ein ziemlich brisantes Detail, das einiges erkläre, „endlich“ in reichlich despektierlicher Formulierung zum Ausdruck gebracht und als widerlich bezeichnet, um es ihr mit nötigender Wirkung unter die Nase zu reiben, ja, sie zu beleidigen und zu demütigen. Sie glaube nun zu wissen, weshalb er sie verachte, doch … nebbich! Genaueres wolle sie darüber nicht aussagen, denn sie fand es beschämend und bringe sie in arge Verlegenheit, da sie überrumpelt worden sei und nicht wisse, wie sie reagieren soll, sie sei verunsichert, wolle ein- oder zweimal darüber schlafen, ehe sie sich zu einer Antwort durchringe. Ich, als Vertrauensperson, als die sie mich seit einiger Zeit schon betrachtete und öfters mal beanspruchte, wunderte mich dennoch über ihr Zaudern, denn wir waren es gewohnt, jeweils das Kind beim Namen zu nennen, sodass ich sogar einige ihrer intimsten Geheimnisse kannte. Ich sprach sehr lange mit ihr, wusste derweil am Ende des Gesprächs nicht, was sie mit dem Telefonat wirklich bezweckte, weil ich den appellativen Aspekt ihrer teils provokativen Aussagen nicht richtig erfasste. Während des ganzen Wochenendes hatte ich ein mulmiges Gefühl, zog mehrfach in Erwägung, zurückzurufen, um mehr über ihre Befindlichkeiten zu erfahren, verwarf aber die Idee immer wieder und verhielt mich schließlich zurückhaltend, blieb aber nervös und besorgt. Instinktiv erahnte ich, dass sich irgendetwas Besonderes abspielte, konnte indes nicht wissen, dass dem tatsächlich so war und wie tragisch es sein würde. Immer wieder drehten sich meine Gedanken um ihren Appell, immer wieder war ich beunruhigt, immer wieder zuckte meine Hand, um zum Telefonhörer zu greifen, immer wieder hielt ich mich zurück, Unruhe und Besorgnis beherrschten die Freitage, ja, im Laufe der folgenden Woche wollte ich mir Klarheit verschaffen, sie vielleicht sogar besuchen, wie ich es gelegentlich tat, nicht zuletzt, um Tacheles zu reden. Ich drückte mich herum, blickte schief auf das wartende Arbeitspensum, erhob mich wieder vom Sessel, ging einige Schritte in Richtung Türe, kehrte wieder um, weil ich nicht wusste, was ich dort wollte, setzte mich erneut hin und versuchte, noch einmal von vorne zu beginnen, ohne Lust und Impetus, weil’s eben sein musste. Was war los? Ganz so schlimm war bisher der Arbeitsbeginn zum Wochenanfang noch nie und nur die Tatsache, dass der Februar zu Ende war und die Hoffnung auf Frühling zu keimen begann, konnte auch nicht der Grund des unverständlichen Hemmnisses sein, das ich damals empfand. Nein, es musste etwas anderes sein als sonst, etwas, das mich irgendwie blockierte, doch was? Ich schaute mich um, erkannte nichts Außergewöhnliches, hörte den Anrufbeantworter ab, keine Besonderheiten - das Übliche bloß - und blätterte den Papierstapel mal provisorisch durch, besichtigte ihn sozusagen im Schnelldurchlauf und fand zunächst nichts Besonderes, nichts, das den üblichen Rahmen gesprengt hätte: Berichte, Formulare, Befunde … Alltägliches nur. Ich tat dasselbe noch und noch und noch einmal, fühlte mich irgendwie dazu gedrängt, als ahnte ich, dass der Stapel etwas Wichtiges enthielte, … und da fand ich plötzlich mitten drin ein Blatt, das meine Aufmerksamkeit erregte:Eine Todesanzeige auf einem simplen Faxpapier … nein, so was Prosaisches gab’s noch nie! Unerhört, schockierend!Ich zog es raus und war erschüttert und fassungslos zugleich: Die anscheinend unverhofft verstorbene Person - ich musste zweimal hinschauen, ehe ich erfasste, was ich in der Hand hielt, denn es betraf ausgerechnet jene Cousine, mit welcher ich mich während des ganzen Wochenendes beschäftigte - war also schon tot, als ich mich unaufhörlich fragte, ob ich sie anrufen sollte, um ihr sozusagen noch einmal den „Puls“ zu fühlen und nachzufragen, was sie denn auf dem Herzen habe … ich hätte sie nicht mehr erreicht, das war mir schlagartig klar … betrüblich; Versagensangst beschlich mein Gewissen … habe wohl nicht gut hingehört! Nun ja, sie hatte für mich und meine Lebensgestaltung eine ganz besondere Bedeutung und die reichlich nüchterne Benachrichtigung drei Tage nach ihrem Todestag, dem Tag nach dem beunruhigenden Telefonat mithin, wirkte wie ein Schlag ins Gesicht … Ich musste mich erst vom Unmut erholen, welchen dieser schäbige Zettel hervorrief, dann erst versuchte ich, von den nächsten Verwandten jemanden telefonisch zu erreichen, um nachzufragen, was sich denn im Einzelnen ereignet habe, hatte ich doch reichlich Gründe anzunehmen, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Fall handeln musste; ich erreichte niemanden und ich blieb allein mit meinen Zweifeln sowie einer Art Schuldgefühl, weil ich zuvor anscheinend zu wenig sensitiv war, um zu wittern, dass sie Abschied nehmen wollte, ja, zur Kenntnis nehmen musste, dass mein hölzerner Realitätssinn offenbar nicht zuließ, den tieferen Sinn, der sich hinter den Worten verbarg, aufzuspüren. Erst Tage später erfuhr ich, wie sich das Ganze abspielte, und wurde auch über die zeitlichen Gegebenheiten informiert. Keiner wollte gewusst haben, dass ich mit der Verstorbenen im Vorfeld des traurigen Ereignisses zahlreiche Gespräche führte und dies zum letzten Mal auch kurz davor. Ich nahm das Blatt, las es langsam mehrmals durch und dabei fiel mir einiges auf: Etwa, dass sie am Tag der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags geboren wurde, genau 5 Jahre nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajewo, welche zur Ursache des Ersten Weltkriegs outriert wurde - ein Nebenbefund, der die Familiengeschichte jedoch tangierte -, vielmehr aber die Kürze und lakonische Form der Anzeige, eine Art Kurzform, welche frostiger nicht hätte ausfallen können; ich war entrüstet und fühlte mich veranlasst, mich intensiver mit der Angelegenheit zu befassen, umso mehr, als ich eben bereits zuvor mit einigen Details, welche in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind, konfrontiert wurde … Und so sah der schäbige Zettel aus, den ich nun in der Hand hielt:
Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere Mutter und Großmutter Martina Borg-Naiger (*28. Juni 1919) am 26. Februar 2005 in Frieden von uns gegangen
Die Trauerfamilie
Unmut
Kein Brief mit schwarzem Rand oder auch ohne, nein, ein banales Fax! Kurz, unscheinbar, nichtssagend … eine unverbindliche Mitteilung an die Öffentlichkeit bloß, emotionslos und knapp: Eine Frau, welche offensichtlich Kinder und Enkel hatte, hat das Zeitliche gesegnet, hartherzig, inhaltslos, beinahe unanständig und despektierlich … ein Wunder nur, dass nicht etwa geschrieben stand, man sei froh, dass sie endlich ein Einsehen hatte und uns von ihrer desolaten Existenz erlöst habe.Wer ist wie und weshalb von uns gegangen, wessen erfülltes Leben - von wegen - ist damit zu Ende gegangen, wer ist die Trauerfamilie, wer gehört dazu, wer nicht … Sicherlich, sie war Mutter und Großmutter, aber auch Tante und Cousine sowie vor allem eine geschätzte Freundin zahlreicher Leute, vieler Künstler und Wissenschaftler, eine Frau also, deren Bedeutung und Beliebtheit weit höher einzuschätzen ist, als aus diesen frugalen Worten hervorgeht. Das Leben sei erfüllt gewesen, inwiefern denn? Eine Floskel, die man gemeinhin benutzt, mehr nicht, ausdrucksloses Geschwätz! Auch lang soll es gewesen sein, wohl zu lang in den Augen jener Person - wer mag es denn gewesen sein? -, der diese Anzeige verfasste. Ja wer, so fragte ich mich, hat denn darüber zu entscheiden, wie lange ein Leben dauern soll und wann es zu lange wird, das zu beurteilen, ist doch unstreitig Privatsache, im höchsten Fall dem Ermessen des jeweiligen ‚Besitzers‘ allein überantwortet, oder etwa nicht?Unverständlich also! Was mag dahinterstecken, welche Tragödien und Misshelligkeiten werden durch diese Todesanzeige verschleiert? Und was heißt denn in Frieden, wessen Frieden? … aus meiner Sicht eine glatte Lüge, denn … Wer war wohl dabei, als sie starb, wer hat sie in den Tod begleitet, um sich legitimiert zu fühlen, eine solch dämliche Aussage zu machen? Ja, natürlich, auch dies eine gängige Floskel, vielleicht ein frommer Wunsch nur, um die Misstöne, welche dem Schicksalstag vorangingen, zu übertönen. Sie sei von ‚Uns‘ gegangen … wer ist mit ‚Uns‘ gemeint, wen hat sie denn verlassen, wem wird sie fehlen? … eine Todesanzeige also aus dem Theater-Fundus, jener Ansammlung abgedroschener Schablonen, welche man im Zweifelsfall der Kiste entnimmt, um sich möglichst ungeschoren aus der Affäre zu ziehen, ja, eine lästige Pflicht zu erfüllen, welche die Gesellschaft einfordert. Selbst dieses ‚Uns‘ ist reine Formsache; ehrlicher wäre es gewesen zu sagen, sie ist gegangen, ohne uns zu fragen, weggegangen, ohne um Erlaubnis anzusuchen oder gar geflohen, weil sie es nicht mehr aushielt … es wird der Sache nicht gerecht, wenn man sie ins gutbürgerliche Schema hineinpresst, selbst wenn sie sich dazu nicht mehr äußern kann. Kurzum, es ist alles verlogen, unpassend und frech. Wodurch hat sie sich das verdient?Ich fühle mich übergangen! Ein Affront, ja fast eine Ohrfeige für mich, der ich diese Frau nicht nur sehr gut kannte, sondern selbst in nahezu letzter Minute - nicht zufällig, wie ich erst dachte - noch Gelegenheit hatte, mit ihr zu sprechen, wohl um ihr einen ‚Freibrief‘ auszustellen, der es ihr erlaubte, alsdann all dies zu vollenden, was wir Wochen und Monate zuvor schon intensiv erörtert haben. Weshalb also wurde sie durch diese kärgliche Anzeige dermaßen entstellt, dass man sie nicht wiedererkannte, weshalb sollten alle Werte, welche mit ihr vergangen sind, unterschlagen werden, ja, wer mochte denn befugt sein, dies zu tun?Ich war nicht nur erbost, ich war buchstäblich aufgebracht, witterte unschöne Begebenheiten, rechnete mit dem Schlimmsten … nein, nicht etwa kriminelle Machenschaften … oder im weitesten Sinne eben doch; womöglich Ansichtssache? Ich wollte es wissen, doch die Hände waren mir gebunden, guter Rat war teuer; nur durch Nachdenken, das sich auf Gesagtes, vielleicht nebenbei Erwähntes stützt, müsste es mir wohl gelingen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen, um fühlbare, aber nicht konkrete Unstimmigkeiten zu eruieren, zumindest aber als Annäherung an die größtmögliche Wahrscheinlichkeit herauszuarbeiten. Ja, genau dies wollte ich tun, den Rest danach erledigen, ich hatte auch meine Befindlichkeiten, die erfüllt sein wollten …
Sonntag, es schneite und der Schnee blieb liegen, mindestens 15 Zentimeter hoch, der Wind war stürmisch und die Kälte beißend. An den geplanten Ausflug in die Berge war nicht zu denken, nein, ich nistete mich zu Hause ein, entfachte ein Kaminfeuer und stellte mich auf einen Lesesonntag ein, wie es einige gab in letzter Zeit, denn wir hatten einen strengen Winter, der sich offensichtlich noch nicht verabschiedet hat. Pech für viele, nicht aber für den Bücherwurm, der sich auf weitere ersprießliche Lektüre freut. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich plötzlich die Idee hatte, in meinem Familienalbum zu blättern und was ich darin suchen wollte. Egal, ich stieß unvermutet auf ein Bild, das mich festhielt, ohne erkennbaren Grund, es sei denn … ja, vielleicht! Ich betrachtete es mit Interesse: Ja natürlich, ich erinnere mich sehr wohl an diese Szene …Es war ein Bild aus der Wohnküche eines Ferienhauses, das wir vor vielen, vielen Jahren für eine Woche mieteten, um Winterferien zu verbringen, und zwar zusammen mit der noch jungen Familie eines Cousins, namens Stan, mit Frau und dem erstgeborenen Kind namens Simonetta. Mit dabei waren deren frischgebackene Großmutter, Martina, sowie meine eigene Familie, die damals bereits vierköpfig war. Es war eine gewöhnliche Szene einer gelangweilten Familie: Die noch versammelte Belegschaft nämlich, welche nach dem Frühstück - die Teller waren schon aufgestapelt, die Tassen leer - noch plaudernd am Tisch sitzen geblieben ist, weil, wohl wetterbedingt, keine Eile angesagt war und keiner wusste, was zu unternehmen sich am ehesten noch anbot … im Vordergrund Martina mit rauchender Zigarette, graumelierten Haaren und Brille, vermutlich sprechend, daneben die Mutter meiner Kinder mit der Zweitgeborenen auf dem Schoß und an der Stirnseite des Tisches die ebenfalls frischgebackene Mutter, Stans Frau, mit Simonetta auf den Armen, Letztere höchstens einige Monate alt, schlafend, satt. Auf der anderen Tischseite saß Stan mit meiner ältesten Tochter auf den Knien, die ihren reichlich abgenutzten Bären namens „Schwarzes Bébé“ herzte. Es sieht alles sehr friedlich aus, zufriedene Gesichter allenthalben, ernsthaft indes der Gesichtsausdruck Martinas, die gerade dabei war, irgendetwas ‚ganz richtig zu sagen‘, nicht erinnerlich indes, worum es dabei ging; ‚Eizes‘ - eines ihrer Lieblingswörter - für die Erziehung wohl? Die Familienidylle, so es denn eine war, schien ungetrübt, sicher aber sind damals Bande neu geknüpft worden, die alsdann lange halten sollten, wenngleich nicht in dieser harmonischen Form. Dieser kritische Gedanke schoss mir augenblicklich durch den Kopf, als ich das Bild betrachtete. Weshalb mich gerade dieses Bild - ich war ja der Fotograf und sah die Szene aus derselben Perspektive wie damals - in seinen Bann zog, war mir nicht klar. Es war eine Momentaufnahme, die ich seinerzeit erfrischend fand und nun als Erinnerungsbild an vergangene Zeiten zur Kenntnis nahm, wenngleich ich dabei ein eigenartiges Gefühl hatte, führte ich doch wenige Tage davor mit der nunmehr betagten Martina ein langes Telefongespräch, dessen Inhalt mich wohl noch immer beschäftigte, denn die Zeit zwischen der auf dem Bild festgehaltenen Szene und dem Telefonat, rund dreißig Jahre, hat, vermöge zahlreicher, teils einschneidender Vorfälle, vieles verändert, das der lockeren Atmosphäre auf dem beschriebenen Bild nicht nur widerspricht, sondern geradezu von gegensätzlicher Art ist. Die Familien zerfielen in ihre „Einzelteile“, um es kurz zu sagen, und sorgten immer mal wieder für heiße Köpfe.Es war offenbar kein Zufall, vielleicht sogar ein seherischer Akt, so man sich eine derartige Fähigkeit zubilligen möchte, dass ich mich eingehend mit diesem Bild beschäftigte, der folgende Montag verschaffte Klarheit …
Todesanzeige auf dem Fax
Nach einer schlaflosen Nacht brach der Montag an, ein gewöhnlicher Montag, wie es mindestens deren 52 pro Jahr gibt, wobei nahezu jeder dem vorangehenden wie auch dem nachfolgenden gleicht wie ein Ei dem anderen. Montag also und sonst nichts; Montage sind ohnehin unbeliebt, doch hartnäckig wiederholen sie sich Woche für Woche, als wären sie einem Pendel der Ewigkeit verpflichtet. Nach einem ersprießlichen Wochenende, sei es aktiver oder passiver Natur, meist ziemlich entspannt, stellt man sich unwillkürlich wieder darauf ein, hektische und zuweilen auch aufregende Stunden durchzustehen, auch stets abzuarbeiten, was anfällt, kurzum, sich in der gewohnten Arbeitswelt wieder zurechtzufinden, das Los des Normalbürgers, dessen sich zu entschlagen, nie gelang. Das ist somit der Normalfall und mitunter gelingt es auch auf Anhieb, sich umzustellen, zuweilen braucht man vielleicht einen Moment, um den Unmut über die allzu rasch dahineilende Zeit zu überwinden, den Unmut vielleicht auch, die Muße, durch das Müssen zu ersetzen.Nun, man nimmt es zunächst gelassen hin, betritt das Büro, um sich am Arbeitsplatz niederzulassen, betrachtet etwa mit einem schiefen Blick, vielleicht sogar etwas verdrießlich den Stapel von Papieren, den es zu erledigen gilt, weiß indes, dass kein Weg daran vorbeiführt, und beginnt, zunächst noch im Tempo der Freizeit, wohl gemächlich, dann mit zunehmendem Eifer und speditiv, Stück um Stück zu erledigen. Die Maschine läuft an, tut ihren Dienst, wie jeden Montag und alle weiteren Werktage auch, Gewohnheit und Routine greifen Platz. Doch dieser Montag hatte einen besonderen „Geruch“, war nicht wie sonst, nicht nur, weil er rein zufällig der letzte Tag im kurzen Monat Februar war, sondern weil zudem irgendetwas in der Luft lag, etwas, das nicht auf Anhieb erkennbar war. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut, kaute noch an jenem eigenartigen Telefongespräch herum, das ich am Freitagabend führte, es wollte mir nicht aus dem Kopf gehen, mir schwante Unheil. Nun ja, die liebe Cousine, mit welcher ich zeitlebens einen recht intensiven Kontakt pflegte, ist mittlerweile in die Jahre gekommen und körperlich angeschlagen, lebte allein in ihrem Haus und hatte reichlich Sorgen, derer sie nicht Herr wurde. Sie rief mich an, um mich offiziell über einen ungewöhnlich hässlichen Brief ihres jüngeren Sohnes zu informieren, den sie selbigen Tages erhielt, in Tat und Wahrheit jedoch aus einem ganz anderen Grund, der sich mir nicht unmittelbar erschloss. Sie las ihn nicht in seiner ganzen Länge vor, erläuterte aber - teilweise, wie sich später herausstellen sollte - dessen Inhalt, der wie immer vorwurfsvoll und anklagend, ja teilweise sogar bösartig war, denn das Verhältnis zu ihm war aus bislang unerfindlichen Gründen massiv gestört. Er habe nun, so dessen wichtigste Eröffnung, ein ziemlich brisantes Detail, das einiges erkläre, „endlich“ in reichlich despektierlicher Formulierung zum Ausdruck gebracht und als widerlich bezeichnet, um es ihr mit nötigender Wirkung unter die Nase zu reiben, ja, sie zu beleidigen und zu demütigen. Sie glaube nun zu wissen, weshalb er sie verachte, doch … nebbich! Genaueres wolle sie darüber nicht aussagen, denn sie fand es beschämend und bringe sie in arge Verlegenheit, da sie überrumpelt worden sei und nicht wisse, wie sie reagieren soll, sie sei verunsichert, wolle ein- oder zweimal darüber schlafen, ehe sie sich zu einer Antwort durchringe. Ich, als Vertrauensperson, als die sie mich seit einiger Zeit schon betrachtete und öfters mal beanspruchte, wunderte mich dennoch über ihr Zaudern, denn wir waren es gewohnt, jeweils das Kind beim Namen zu nennen, sodass ich sogar einige ihrer intimsten Geheimnisse kannte. Ich sprach sehr lange mit ihr, wusste derweil am Ende des Gesprächs nicht, was sie mit dem Telefonat wirklich bezweckte, weil ich den appellativen Aspekt ihrer teils provokativen Aussagen nicht richtig erfasste. Während des ganzen Wochenendes hatte ich ein mulmiges Gefühl, zog mehrfach in Erwägung, zurückzurufen, um mehr über ihre Befindlichkeiten zu erfahren, verwarf aber die Idee immer wieder und verhielt mich schließlich zurückhaltend, blieb aber nervös und besorgt. Instinktiv erahnte ich, dass sich irgendetwas Besonderes abspielte, konnte indes nicht wissen, dass dem tatsächlich so war und wie tragisch es sein würde. Immer wieder drehten sich meine Gedanken um ihren Appell, immer wieder war ich beunruhigt, immer wieder zuckte meine Hand, um zum Telefonhörer zu greifen, immer wieder hielt ich mich zurück, Unruhe und Besorgnis beherrschten die Freitage, ja, im Laufe der folgenden Woche wollte ich mir Klarheit verschaffen, sie vielleicht sogar besuchen, wie ich es gelegentlich tat, nicht zuletzt, um Tacheles zu reden. Ich drückte mich herum, blickte schief auf das wartende Arbeitspensum, erhob mich wieder vom Sessel, ging einige Schritte in Richtung Türe, kehrte wieder um, weil ich nicht wusste, was ich dort wollte, setzte mich erneut hin und versuchte, noch einmal von vorne zu beginnen, ohne Lust und Impetus, weil’s eben sein musste. Was war los? Ganz so schlimm war bisher der Arbeitsbeginn zum Wochenanfang noch nie und nur die Tatsache, dass der Februar zu Ende war und die Hoffnung auf Frühling zu keimen begann, konnte auch nicht der Grund des unverständlichen Hemmnisses sein, das ich damals empfand. Nein, es musste etwas anderes sein als sonst, etwas, das mich irgendwie blockierte, doch was? Ich schaute mich um, erkannte nichts Außergewöhnliches, hörte den Anrufbeantworter ab, keine Besonderheiten - das Übliche bloß - und blätterte den Papierstapel mal provisorisch durch, besichtigte ihn sozusagen im Schnelldurchlauf und fand zunächst nichts Besonderes, nichts, das den üblichen Rahmen gesprengt hätte: Berichte, Formulare, Befunde … Alltägliches nur. Ich tat dasselbe noch und noch und noch einmal, fühlte mich irgendwie dazu gedrängt, als ahnte ich, dass der Stapel etwas Wichtiges enthielte, … und da fand ich plötzlich mitten drin ein Blatt, das meine Aufmerksamkeit erregte:Eine Todesanzeige auf einem simplen Faxpapier … nein, so was Prosaisches gab’s noch nie! Unerhört, schockierend!Ich zog es raus und war erschüttert und fassungslos zugleich: Die anscheinend unverhofft verstorbene Person - ich musste zweimal hinschauen, ehe ich erfasste, was ich in der Hand hielt, denn es betraf ausgerechnet jene Cousine, mit welcher ich mich während des ganzen Wochenendes beschäftigte - war also schon tot, als ich mich unaufhörlich fragte, ob ich sie anrufen sollte, um ihr sozusagen noch einmal den „Puls“ zu fühlen und nachzufragen, was sie denn auf dem Herzen habe … ich hätte sie nicht mehr erreicht, das war mir schlagartig klar … betrüblich; Versagensangst beschlich mein Gewissen … habe wohl nicht gut hingehört! Nun ja, sie hatte für mich und meine Lebensgestaltung eine ganz besondere Bedeutung und die reichlich nüchterne Benachrichtigung drei Tage nach ihrem Todestag, dem Tag nach dem beunruhigenden Telefonat mithin, wirkte wie ein Schlag ins Gesicht … Ich musste mich erst vom Unmut erholen, welchen dieser schäbige Zettel hervorrief, dann erst versuchte ich, von den nächsten Verwandten jemanden telefonisch zu erreichen, um nachzufragen, was sich denn im Einzelnen ereignet habe, hatte ich doch reichlich Gründe anzunehmen, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Fall handeln musste; ich erreichte niemanden und ich blieb allein mit meinen Zweifeln sowie einer Art Schuldgefühl, weil ich zuvor anscheinend zu wenig sensitiv war, um zu wittern, dass sie Abschied nehmen wollte, ja, zur Kenntnis nehmen musste, dass mein hölzerner Realitätssinn offenbar nicht zuließ, den tieferen Sinn, der sich hinter den Worten verbarg, aufzuspüren. Erst Tage später erfuhr ich, wie sich das Ganze abspielte, und wurde auch über die zeitlichen Gegebenheiten informiert. Keiner wollte gewusst haben, dass ich mit der Verstorbenen im Vorfeld des traurigen Ereignisses zahlreiche Gespräche führte und dies zum letzten Mal auch kurz davor. Ich nahm das Blatt, las es langsam mehrmals durch und dabei fiel mir einiges auf: Etwa, dass sie am Tag der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags geboren wurde, genau 5 Jahre nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajewo, welche zur Ursache des Ersten Weltkriegs outriert wurde - ein Nebenbefund, der die Familiengeschichte jedoch tangierte -, vielmehr aber die Kürze und lakonische Form der Anzeige, eine Art Kurzform, welche frostiger nicht hätte ausfallen können; ich war entrüstet und fühlte mich veranlasst, mich intensiver mit der Angelegenheit zu befassen, umso mehr, als ich eben bereits zuvor mit einigen Details, welche in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind, konfrontiert wurde … Und so sah der schäbige Zettel aus, den ich nun in der Hand hielt:
Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere Mutter und Großmutter Martina Borg-Naiger (*28. Juni 1919) am 26. Februar 2005 in Frieden von uns gegangen
Die Trauerfamilie
Unmut
Kein Brief mit schwarzem Rand oder auch ohne, nein, ein banales Fax! Kurz, unscheinbar, nichtssagend … eine unverbindliche Mitteilung an die Öffentlichkeit bloß, emotionslos und knapp: Eine Frau, welche offensichtlich Kinder und Enkel hatte, hat das Zeitliche gesegnet, hartherzig, inhaltslos, beinahe unanständig und despektierlich … ein Wunder nur, dass nicht etwa geschrieben stand, man sei froh, dass sie endlich ein Einsehen hatte und uns von ihrer desolaten Existenz erlöst habe.Wer ist wie und weshalb von uns gegangen, wessen erfülltes Leben - von wegen - ist damit zu Ende gegangen, wer ist die Trauerfamilie, wer gehört dazu, wer nicht … Sicherlich, sie war Mutter und Großmutter, aber auch Tante und Cousine sowie vor allem eine geschätzte Freundin zahlreicher Leute, vieler Künstler und Wissenschaftler, eine Frau also, deren Bedeutung und Beliebtheit weit höher einzuschätzen ist, als aus diesen frugalen Worten hervorgeht. Das Leben sei erfüllt gewesen, inwiefern denn? Eine Floskel, die man gemeinhin benutzt, mehr nicht, ausdrucksloses Geschwätz! Auch lang soll es gewesen sein, wohl zu lang in den Augen jener Person - wer mag es denn gewesen sein? -, der diese Anzeige verfasste. Ja wer, so fragte ich mich, hat denn darüber zu entscheiden, wie lange ein Leben dauern soll und wann es zu lange wird, das zu beurteilen, ist doch unstreitig Privatsache, im höchsten Fall dem Ermessen des jeweiligen ‚Besitzers‘ allein überantwortet, oder etwa nicht?Unverständlich also! Was mag dahinterstecken, welche Tragödien und Misshelligkeiten werden durch diese Todesanzeige verschleiert? Und was heißt denn in Frieden, wessen Frieden? … aus meiner Sicht eine glatte Lüge, denn … Wer war wohl dabei, als sie starb, wer hat sie in den Tod begleitet, um sich legitimiert zu fühlen, eine solch dämliche Aussage zu machen? Ja, natürlich, auch dies eine gängige Floskel, vielleicht ein frommer Wunsch nur, um die Misstöne, welche dem Schicksalstag vorangingen, zu übertönen. Sie sei von ‚Uns‘ gegangen … wer ist mit ‚Uns‘ gemeint, wen hat sie denn verlassen, wem wird sie fehlen? … eine Todesanzeige also aus dem Theater-Fundus, jener Ansammlung abgedroschener Schablonen, welche man im Zweifelsfall der Kiste entnimmt, um sich möglichst ungeschoren aus der Affäre zu ziehen, ja, eine lästige Pflicht zu erfüllen, welche die Gesellschaft einfordert. Selbst dieses ‚Uns‘ ist reine Formsache; ehrlicher wäre es gewesen zu sagen, sie ist gegangen, ohne uns zu fragen, weggegangen, ohne um Erlaubnis anzusuchen oder gar geflohen, weil sie es nicht mehr aushielt … es wird der Sache nicht gerecht, wenn man sie ins gutbürgerliche Schema hineinpresst, selbst wenn sie sich dazu nicht mehr äußern kann. Kurzum, es ist alles verlogen, unpassend und frech. Wodurch hat sie sich das verdient?Ich fühle mich übergangen! Ein Affront, ja fast eine Ohrfeige für mich, der ich diese Frau nicht nur sehr gut kannte, sondern selbst in nahezu letzter Minute - nicht zufällig, wie ich erst dachte - noch Gelegenheit hatte, mit ihr zu sprechen, wohl um ihr einen ‚Freibrief‘ auszustellen, der es ihr erlaubte, alsdann all dies zu vollenden, was wir Wochen und Monate zuvor schon intensiv erörtert haben. Weshalb also wurde sie durch diese kärgliche Anzeige dermaßen entstellt, dass man sie nicht wiedererkannte, weshalb sollten alle Werte, welche mit ihr vergangen sind, unterschlagen werden, ja, wer mochte denn befugt sein, dies zu tun?Ich war nicht nur erbost, ich war buchstäblich aufgebracht, witterte unschöne Begebenheiten, rechnete mit dem Schlimmsten … nein, nicht etwa kriminelle Machenschaften … oder im weitesten Sinne eben doch; womöglich Ansichtssache? Ich wollte es wissen, doch die Hände waren mir gebunden, guter Rat war teuer; nur durch Nachdenken, das sich auf Gesagtes, vielleicht nebenbei Erwähntes stützt, müsste es mir wohl gelingen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen, um fühlbare, aber nicht konkrete Unstimmigkeiten zu eruieren, zumindest aber als Annäherung an die größtmögliche Wahrscheinlichkeit herauszuarbeiten. Ja, genau dies wollte ich tun, den Rest danach erledigen, ich hatte auch meine Befindlichkeiten, die erfüllt sein wollten …