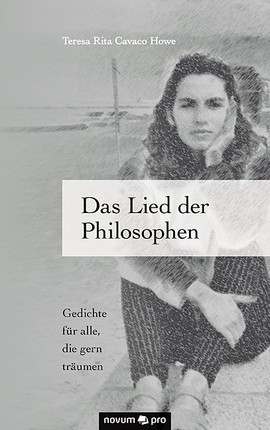Anna und die fremde Frau
Erzählungen
Viola Trüb-Girardi
EUR 19,90
EUR 11,99
Format: 13,5 x 21,5 cm
Seitenanzahl: 90
ISBN: 978-3-99048-458-6
Erscheinungsdatum: 14.01.2016
In einfühlsamen Erzählungen begleiten wir Anna durch ihr ganzes Leben. Das feinfühlige Mädchen versetzt sich gerne in andere Menschen, auch solche, die „anders“ sind. Mit zunehmendem Alter macht sie sich auch immer mehr Gedanken über den Sinn des Lebens …
Für Liliane und Eveline
Er ist gekommen
Der Wald, dachte Anna, der schöne Wald, in den sie fast jeden Tag während des ganzen Jahres ging, war Sinnbild des Lebens. Hier konnte man das leise Erwachen, das Werden zur Vollendung und das allmähliche Vergehen und Ruhen der Natur beobachten.
Wenn sie an einem kalten Morgen im Februar den verschneiten Wald durchstreifte, herrschte Stille, lautlose Stille. Kein Lebewesen war zu sehen und zu hören, alles ruhte: die Pflanzen unter der schneebedeckten Erde, die Tiere in ihren Winterverstecken, die Menschen in ihren warmen Wohnungen.
Und doch, diese lautlose Stille war von einer eigenartigen Erwartung erfüllt.
Im März kam es jedes Mal über sie, das leise Verlangen, die leise Sehnsucht nach neuem Erwachen. Die Bäume waren noch kahl, viel Licht konnte bis zum Waldboden dringen, da begann es sachte, das neue Leben des Waldes. Zwischen Schneeresten streckten die ersten Blümchen ihre filzigen Stiele mit gelben Köpfchen hervor, der Huflattich war erster Frühlingsbote. Und ein ahnungsvoller, süßer Duft lag in der Luft. Etwas später erschienen Buschwindröschen. Als Kind nannten wir sie Guggublümchen. Sie breiteten sich mit ihren dunkelgrünen Blättern und weißen Kelchen überall aus.
Im April konnte es vorkommen, dass der Winter nochmals Herr werden wollte, es schneite, und alle Bäume standen wieder in weißem Schmuck da. Doch die Sonne hatte jetzt schon viel Kraft, und bald war aller Schnee wieder geschmolzen. Bäume und Sträucher trieben grüne Knospen, die Tannen hatten hellgrüne Spitzen an den Zweigen, und da, auf dem moosigen Boden, lugten die von Anna so sehr erwarteten gelben Schlüsselblumen hervor. Sie pflückte ein paar und roch an ihnen. Ja, das war er, der ersehnte Duft des Frühlings.
Wenn sie, so Anfang Mai, einmal erst nach einer Woche wieder in den Wald kam, staunte sie. Sie befand sich in einem Meer von Hellgrün. Alle Bäume und Sträucher trugen hellgrünen Blätterschmuck. Der Wald stand in voller Schönheit da. Buchfinken, Meisen, Eichelhäher jubilierten in den Zweigen. Spechte hämmerten an Baumrinden, und ein Milan zog seine weiten Kreise über den Bäumen.
Frühling, ja du bist’s, das Wunder ist geschehen!
Feierabend
Es war während der Kriegszeit in einer kleinen Dachwohnung in der großen Stadt.
Der Erstklässler Andreas saß am Stubentisch und machte Schulaufgaben. Die Hängelampe über dem Tisch spendete warmes Licht. Der trübe Novembernachmittag neigte sich seinem Ende zu. Im kleinen Kachelofen knisterte das Holz. Als es nur noch glühte, packte die Mutter Kohlen-Briketts in Zeitungspapier und schob sie in die Ofentüre. „So hält die Wärme länger an“, sagte sie.
„Schau, Mutter, jetzt habe ich die Reihe Achter fertig.“ Andreas hielt ihr das Heft mit der karierten Seite entgegen. Er hatte Zahlen geschrieben. Jede Zahl hatte er zuerst mit Bleistift auf den Karos mit Pünktchen markiert. Die Einer brauchten drei, die Achter waren die schwierigsten, sie brauchten sieben Punkte. Zerstreut schaute die Mutter auf das Heft. „Das hast du schön gemacht“, sagte sie.
Ihr Blick ging auf die alte Pendeluhr an der Wand. „Fünf Uhr, jetzt hat Vater Feierabend“, sagte sie. Andreas schaute die Mutter an. Ihre Augen hatten einen sonderbaren Ausdruck.
Dann ging sie in den Korridor. Dort hing ein Spiegel an der Wand. Sie nahm Haarbürste und Lippenstift aus der Kommoden-Schublade und bürstete ihr braunes Haar, das in etwas wirren Locken um ihr schmales Gesicht hing. Dann zog sie die Lippen mit dem Stift rot nach. Sie ist schön, dachte Andreas.
Die Mutter schaute kurz auf das Telefon an der Wand, dann verschwand sie in der Küche.
„Du kannst noch mit deinem Baukasten spielen!“, rief sie Andreas zu. Sie zog die Schürze an und schaltete den alten Radioapparat an. Durch die offene Küchentür hörte Andreas den Sender Beromünster. Eine Stimme erstattete Bericht über die neuesten Kriegsereignisse aus dem Ausland. Andreas verstand nichts davon.
Da läutete es. Rasch war die Mutter an der Wohnungstür. Es war nur Beat, der Nachbarsjunge. Er fragte, ob Andreas zu ihm spielen kommen dürfe.
„Nein“, sagte die Mutter, „es ist ja schon Abend, wir essen bald zu Nacht.“
Andreas seufzte, er dachte an die elektrische Eisenbahn von Beat. Dann schaute er in das enttäuschte Gesicht der Mutter, sagte nichts und kehrte zu seinem Baukasten zurück.
Es währte lange. Die Wanduhr schlug siebenmal. Da, was waren das für verhaltene Töne aus der Küche? Andreas eilte zur Mutter. Sie saß am Küchentisch, hatte den Kopf auf die verschränkten Arme gelegt und weinte leise.
„Was hast du?“, fragte er.
„Ach nichts“, meinte sie. Sie schaute ihren Jungen an und sagte: „Jetzt kommt der Vater noch lange nicht nach Hause, jetzt wollen wir es zusammen gemütlich haben. Ich mache uns eine Apfel-Rösti, die du so gerne hast.“ Braune, geschrumpfte Lederäpfel lagen auf dem Tisch. Die Mutter schnitt hartes Brot in kleine Stücke und gab sie mit den zerkleinerten Äpfeln in eine Bratpfanne, in der sie vorher etwas Butter geschmolzen hatte, dann kamen noch Rosinen, Zucker und Zimt dazu, und der gute Schmaus war fertig. Draußen war es ganz dunkel, ein paar erste Schneeflocken wirbelten an das Fenster. Die Mutter zündete eine Kerze an. Sie aßen langsam. „Wenn es Schnee gibt“, sagte Andreas, „mache ich für dich im Hof einen Schneemann, nur für dich allein.“
„Ja“, sagte sie und umarmte ihren Buben. „Jetzt ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen, putze die Zähne und zieh dich aus, ich komme dann zum Gutenachtsagen.“ „Erzählst du mir noch eine Geschichte? Die vom Hans im Glück?“, fragte Andreas. „Ja“, sagte die Mutter.
„Wann kommt der Vater nach Hause?“, fragte Andreas.
„Ich weiß es nicht“, sagte sie.
Die Mutter hatte die Geschichte erzählt, sie hatte Andreas einen Gutenachtkuss gegeben und war aus dem Kinderzimmer gegangen. Die Tür hatte sie hinter sich zugezogen.
Andreas lag still im Bett. Er wusste ja, wo der Vater war. In der Kneipe mit seinen Kumpanen war er. Dort verbrachte er den Feierabend. Dort wurde Bier getrunken, gelärmt und gelacht. „Ich hasse ihn, ich hasse ihn!“, schluchzte Andreas in sein Kissen.
Plötzlich hörte er, wie die Mutter Mantel und Schuhe anzog. Sie öffnete leise die Tür zu Andreas Zimmer und schaute zu seinem Bett. Er stellte sich schlafend. Da ging sie aus der Wohnung. Andreas wusste, sie ging den Vater suchen.
Andreas hatte Angst, er war allein, er konnte sich nicht mehr rühren. Die Kehle war wie zugeschnürt. Lange lag er ganz steif da. Er hörte das Ticken der Uhr, er hörte, wie sie elfmal schlug. Da hielt er es nicht länger aus. Er schlich im Nachthemd in den kalten Korridor hinter die Wohnungstür. Er drückte die Falle, die Tür war verschlossen. Andreas stand da und horchte ins Treppenhaus hinaus. Er hörte Schritte. Waren es die Eltern? Nein, die Schritte verhallten, eine Tür wurde geöffnet, Lachen drang aus der unteren Wohnung, dann war es wieder still. Andreas schlotterte, der Korridor war nicht geheizt. Jetzt schlug die Uhr zwölfmal. Eine lange Zeit verging, da vernahm er wieder Schritte, sie kamen höher und höher hinauf und … ja, es waren Vater und Mutter, er hörte ihre Stimmen, Gott sei Dank, Vaters Stimme klang nicht böse.
Da huschte Andreas schnell wieder in sein Bett, zog die Decke zu sich herauf, drehte sich zur Seite und schloss die Augen.
Die Wohnungstür wurde geöffnet. „Mach leise“, sagte die Mutter, „damit der Kleine nicht aufwacht.“ Sie kamen ins Kinderzimmer und sahen ihren schlafenden Jungen an. Lange sagten sie nichts. Da spürte Andreas plötzlich, wie der Vater ihm mit seiner harten Arbeiterhand über die Haare strich.
Als die Eltern gegangen waren, zog Andreas unter der Decke seine Knie ganz nahe zu sich heran und fing an zu schluchzen. Er schluchzte aus übergroßer Erleichterung, denn für diese Nacht war seine Welt wieder in Ordnung.
Onkel Giacomo
Es war im Jahre 1940 vor Ostern. Für die 7-jährige Marietta war Ostern das schönste Fest des Jahres. Da fuhren Vater Guiseppe, Mutter Erika, Marietta und ihr kleiner Bruder Carlo zur Nonna, der italienischen Großmutter, nach St. Gallen. Und man fuhr mit der Eisenbahn! Das kam nur einmal im Jahr vor, eben an Ostern.
Ostersonntag in der Früh stieg die Familie im Zürcher Hauptbahnhof in den Zug, in einen Wagen dritter Klasse. Die Bänke waren aus Holz, es roch nach abgestandenem Zigarettenrauch. Etliche Fahrgäste waren schon da. Ein Abteil mit 4 Plätzen war aber noch frei. Die Kinder stürzten zum Fenster, zogen es hinunter und streckten die Köpfe hinaus. „Lies mal, was auf diesem Email-Schild steht“, sagte der Vater zu Marietta.
„Nicht hinauslehnen“, buchstabierte sie. „Und da hat es noch eine Tafel, was steht da drauf?“, fragte Carlo.
„Nicht auf den Boden spucken“, las die Mutter vor. Da schaute sich Carlo um. Niemand sah zu ihm her. Schnell spuckte er verstohlen ein bisschen auf den Boden.
Der Zug fuhr an. War das aufregend! Ein wenig lehnte man schon zum Fenster hinaus und ließ sich den Wind durch die Haare wehen. An einigen Stationen hielt der Zug an. Nach etwa anderthalb Stunden war man am Ziel.
Die Nonna wohnte in der Altstadt. Als der Vater an der alten Wohnungstür läutete, öffnete die Großmutter. Sie war eben von der Ostermesse heimgekommen und trug noch ihr schwarzes Sonntags-Seidenkleid. Eine Goldkette mit einem Medaillon baumelte auf ihrer Brust, und in den Ohren trug sie goldene Ringe. Das noch fast schwarze Haar hatte sie kunstvoll aufgesteckt. „Meine lieben Schatzeli sind gekommen!“, rief sie und drückte Marietta und Carlo an ihr Herz. „Kommt herein.“ In der Stube saß am alten Klavier Onkel Giacomo, der schiefe Giacomo, wie ihn die Leute nannten. Er war Vaters jüngster Bruder und hatte ein Geburtsgebrechen. Seine linke Hüfte war verwachsen. Mit seinem schiefen Gang hinkte er der Familie entgegen. Er lächelte freundlich. „Tschau Bella“, sagte er zu Marietta. „Dürfen wir Klavier spielen, Onkel Giacomo?“, fragten die Kinder.
„Also, so kommt, ihr Rangen“, lachte er. Er zeigte ihnen geduldig die Tasten und lehrte Marietta „Alle meine Entlein“ spielen. Jetzt wollte es auch Carlo versuchen.
Da kam Cousine Ramona herbeigesprungen. Sie war die Tochter von Tante Norma, die bei der Nonna lebte. „Kommt, ich zeige euch mein Oster-Nestchen!“, rief sie. In ihrem Nestchen saß ein Osterhase aus rotem Zucker. So einen Hasen hatte Marietta noch nie gesehen. Die Osterhasen zu Hause waren immer aus Schokolade. Sofort wünschte sich Marietta sehnlichst einen solchen roten Hasen, wie Ramona ihn hatte. Da kam die Nonna herein und sagte zu Carlo und Marietta: „Suchen gehen, vielleicht hat es noch mehr Osternester.“ Und siehe da, sie fanden jedes ein Nestchen mit einem roten Zuckerhasen inmitten von kleinen Schoggieiern. Marietta war begeistert.
Da läutete es an der Wohnungstür, neuer Besuch kam. Laute Stimmen tönten durcheinander. Es waren Vaters Brüder Mario, Ettore und Bruno. Alle setzten sich an den runden Tisch. Die Nonna war glücklich. Ihre ganze Familie war da. Sie kam mit einer riesigen blechernen Kaffeekanne in die Stube. Der Kaffee war stark und bereits gesüßt. Tante Norma stellte geblümte Tassen auf den Tisch und brachte auf einer Platte einen großen Panettone. Die Kinder bekamen Sirup. Ein Korb mit gefärbten Ostereiern stand vor ihnen.
Nun begann zwischen Giuseppe, Ettore, Mario und Bruno ein Diskutieren und Gestikulieren, sie redeten laut, und zwar Italienisch. Besonders Ettore ereiferte sich zusehends, der elegante Bruno (er trug graue Wildledergamaschen über seinen modischen Schuhen) stichelte ihn immer mehr an. „Streiten sie?“, fragte Carlo die Nonna.
„Nein, nein, politisieren, immer nur politisieren, und das an Ostern“, schimpfte sie. Onkel Bruno lachte. „Mamma mia!“, rief er und legte seinen Arm zärtlich um die Nonna. „Geh du zur Madonna in die Kirche und zünde für uns Sünder eine Kerze an.“
Onkel Giacomo aber saß an einem kleinen Nebentisch, er hatte einen großen Zeichenblock vor sich. Außer Klavierspielen hatte er noch mehr Talente. Er konnte wunderbar zeichnen. Durch seinen schwarzen Stift entstanden Karikaturen von allen Anwesenden.
Die Kinder machten „Eiertütschis“, dazwischen liefen sie zu Giacomo und jubelten, wenn sie wieder ein Familienmitglied erkannten. Zuletzt hinkte der Onkel an den großen Tisch und legte jedem sein Konterfei hin. Da gab es verblüffte Gesichter. Es ist ja nicht immer so angenehm, sich als Karikatur zu sehen. Zuletzt aber siegte der Humor, und alle lachten.
„Onkel Giacomo, zauberst du noch ein wenig?“, fragte Carlo.
„Ach, zaubern, schaut lieber mal zu euren Osternestern“, meinte er. Ja, was sahen da die Kinder? Nur noch ein paar Schoggi-Eilein lagen darin, die roten Zuckerhasen waren verschwunden.
Jetzt begann ein Suchen. Die Nonna kam mit einer neuen Kanne Kaffee herein, und was guckte da aus der Tasche ihrer Küchenschürze? Etwas Rotes. „Das ist mein Hase!“, rief Ramona und ergriff ihn schnell. Marietta musterte den grau-schwarz gestreiften Blazer von Onkel Bruno und sah plötzlich zwei rote Ohren aus seiner Tasche gucken. „Mein Hase!“, rief sie und packte ihn. Fast gleichzeitig entdeckte auch Carlo seinen Osterhasen, er saß auf Vaters Schoß.
Nun kehrten die Kinder zu ihrem Korb mit den bunten Eiern zurück. Aber da waren keine Eier mehr! Onkel Giacomo humpelte herum. Er zog ein rotes Ei aus Onkel Ettores Jackenärmel, ein blaues aus dem Hosenbein von Onkel Mario, ein grünes sogar aus dem runden Ausschnitt von Tante Norma. Die Erwachsenen lachten, die Kinder staunten.
Plötzlich aber war Onkel Giacomo müde. Er kehrte still an seinen Platz zurück. Die Kinder wussten: Jetzt musste man ihn in Ruhe lassen.
Als es Abend wurde, stellte Tante Norma vor jeden Platz einen Suppenteller mit Löffel, dann kam sie mit einer großen Schüssel Minestrone, nach Nonnas Geheimrezept zubereitet, herein. Dazu gab es Weißbrot, Salami und Coppa. Zwei große Korbflaschen Chianti standen da, das Fest konnte weitergehen.
Dann war es Zeit zum Aufbrechen. Marietta lief noch schnell zu Onkel Giacomo. Er saß still auf seinem Stuhl mit einem Kissen im Rücken und hatte die Augen geschlossen. „Danke, Onkel Giacomo“, sagte Marietta.
Er öffnete die Augen. Ein müdes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. „Hat es euch Spaß gemacht?“, fragte er. Er drückte Mariettas Hand. „Tschau Bella“, sagte er noch und schloss wieder die Augen.
„Sepp“, sagte auf der Heimfahrt die Mutter zu ihrem Mann: „Du hast eine herrliche Familie. Bin ich froh, einen Italiener geheiratet zu haben.“ Und sie gab ihm einen Kuss.
„Am liebsten von allen habe ich Onkel Giacomo“, sagte Carlo. „Er kann so viele tolle Sachen.“
Wie hat er nur meinen roten Zucker-Osterhasen in Onkel Brunos Jackentasche gezaubert?, dachte Marietta.
Er ist gekommen
Der Wald, dachte Anna, der schöne Wald, in den sie fast jeden Tag während des ganzen Jahres ging, war Sinnbild des Lebens. Hier konnte man das leise Erwachen, das Werden zur Vollendung und das allmähliche Vergehen und Ruhen der Natur beobachten.
Wenn sie an einem kalten Morgen im Februar den verschneiten Wald durchstreifte, herrschte Stille, lautlose Stille. Kein Lebewesen war zu sehen und zu hören, alles ruhte: die Pflanzen unter der schneebedeckten Erde, die Tiere in ihren Winterverstecken, die Menschen in ihren warmen Wohnungen.
Und doch, diese lautlose Stille war von einer eigenartigen Erwartung erfüllt.
Im März kam es jedes Mal über sie, das leise Verlangen, die leise Sehnsucht nach neuem Erwachen. Die Bäume waren noch kahl, viel Licht konnte bis zum Waldboden dringen, da begann es sachte, das neue Leben des Waldes. Zwischen Schneeresten streckten die ersten Blümchen ihre filzigen Stiele mit gelben Köpfchen hervor, der Huflattich war erster Frühlingsbote. Und ein ahnungsvoller, süßer Duft lag in der Luft. Etwas später erschienen Buschwindröschen. Als Kind nannten wir sie Guggublümchen. Sie breiteten sich mit ihren dunkelgrünen Blättern und weißen Kelchen überall aus.
Im April konnte es vorkommen, dass der Winter nochmals Herr werden wollte, es schneite, und alle Bäume standen wieder in weißem Schmuck da. Doch die Sonne hatte jetzt schon viel Kraft, und bald war aller Schnee wieder geschmolzen. Bäume und Sträucher trieben grüne Knospen, die Tannen hatten hellgrüne Spitzen an den Zweigen, und da, auf dem moosigen Boden, lugten die von Anna so sehr erwarteten gelben Schlüsselblumen hervor. Sie pflückte ein paar und roch an ihnen. Ja, das war er, der ersehnte Duft des Frühlings.
Wenn sie, so Anfang Mai, einmal erst nach einer Woche wieder in den Wald kam, staunte sie. Sie befand sich in einem Meer von Hellgrün. Alle Bäume und Sträucher trugen hellgrünen Blätterschmuck. Der Wald stand in voller Schönheit da. Buchfinken, Meisen, Eichelhäher jubilierten in den Zweigen. Spechte hämmerten an Baumrinden, und ein Milan zog seine weiten Kreise über den Bäumen.
Frühling, ja du bist’s, das Wunder ist geschehen!
Feierabend
Es war während der Kriegszeit in einer kleinen Dachwohnung in der großen Stadt.
Der Erstklässler Andreas saß am Stubentisch und machte Schulaufgaben. Die Hängelampe über dem Tisch spendete warmes Licht. Der trübe Novembernachmittag neigte sich seinem Ende zu. Im kleinen Kachelofen knisterte das Holz. Als es nur noch glühte, packte die Mutter Kohlen-Briketts in Zeitungspapier und schob sie in die Ofentüre. „So hält die Wärme länger an“, sagte sie.
„Schau, Mutter, jetzt habe ich die Reihe Achter fertig.“ Andreas hielt ihr das Heft mit der karierten Seite entgegen. Er hatte Zahlen geschrieben. Jede Zahl hatte er zuerst mit Bleistift auf den Karos mit Pünktchen markiert. Die Einer brauchten drei, die Achter waren die schwierigsten, sie brauchten sieben Punkte. Zerstreut schaute die Mutter auf das Heft. „Das hast du schön gemacht“, sagte sie.
Ihr Blick ging auf die alte Pendeluhr an der Wand. „Fünf Uhr, jetzt hat Vater Feierabend“, sagte sie. Andreas schaute die Mutter an. Ihre Augen hatten einen sonderbaren Ausdruck.
Dann ging sie in den Korridor. Dort hing ein Spiegel an der Wand. Sie nahm Haarbürste und Lippenstift aus der Kommoden-Schublade und bürstete ihr braunes Haar, das in etwas wirren Locken um ihr schmales Gesicht hing. Dann zog sie die Lippen mit dem Stift rot nach. Sie ist schön, dachte Andreas.
Die Mutter schaute kurz auf das Telefon an der Wand, dann verschwand sie in der Küche.
„Du kannst noch mit deinem Baukasten spielen!“, rief sie Andreas zu. Sie zog die Schürze an und schaltete den alten Radioapparat an. Durch die offene Küchentür hörte Andreas den Sender Beromünster. Eine Stimme erstattete Bericht über die neuesten Kriegsereignisse aus dem Ausland. Andreas verstand nichts davon.
Da läutete es. Rasch war die Mutter an der Wohnungstür. Es war nur Beat, der Nachbarsjunge. Er fragte, ob Andreas zu ihm spielen kommen dürfe.
„Nein“, sagte die Mutter, „es ist ja schon Abend, wir essen bald zu Nacht.“
Andreas seufzte, er dachte an die elektrische Eisenbahn von Beat. Dann schaute er in das enttäuschte Gesicht der Mutter, sagte nichts und kehrte zu seinem Baukasten zurück.
Es währte lange. Die Wanduhr schlug siebenmal. Da, was waren das für verhaltene Töne aus der Küche? Andreas eilte zur Mutter. Sie saß am Küchentisch, hatte den Kopf auf die verschränkten Arme gelegt und weinte leise.
„Was hast du?“, fragte er.
„Ach nichts“, meinte sie. Sie schaute ihren Jungen an und sagte: „Jetzt kommt der Vater noch lange nicht nach Hause, jetzt wollen wir es zusammen gemütlich haben. Ich mache uns eine Apfel-Rösti, die du so gerne hast.“ Braune, geschrumpfte Lederäpfel lagen auf dem Tisch. Die Mutter schnitt hartes Brot in kleine Stücke und gab sie mit den zerkleinerten Äpfeln in eine Bratpfanne, in der sie vorher etwas Butter geschmolzen hatte, dann kamen noch Rosinen, Zucker und Zimt dazu, und der gute Schmaus war fertig. Draußen war es ganz dunkel, ein paar erste Schneeflocken wirbelten an das Fenster. Die Mutter zündete eine Kerze an. Sie aßen langsam. „Wenn es Schnee gibt“, sagte Andreas, „mache ich für dich im Hof einen Schneemann, nur für dich allein.“
„Ja“, sagte sie und umarmte ihren Buben. „Jetzt ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen, putze die Zähne und zieh dich aus, ich komme dann zum Gutenachtsagen.“ „Erzählst du mir noch eine Geschichte? Die vom Hans im Glück?“, fragte Andreas. „Ja“, sagte die Mutter.
„Wann kommt der Vater nach Hause?“, fragte Andreas.
„Ich weiß es nicht“, sagte sie.
Die Mutter hatte die Geschichte erzählt, sie hatte Andreas einen Gutenachtkuss gegeben und war aus dem Kinderzimmer gegangen. Die Tür hatte sie hinter sich zugezogen.
Andreas lag still im Bett. Er wusste ja, wo der Vater war. In der Kneipe mit seinen Kumpanen war er. Dort verbrachte er den Feierabend. Dort wurde Bier getrunken, gelärmt und gelacht. „Ich hasse ihn, ich hasse ihn!“, schluchzte Andreas in sein Kissen.
Plötzlich hörte er, wie die Mutter Mantel und Schuhe anzog. Sie öffnete leise die Tür zu Andreas Zimmer und schaute zu seinem Bett. Er stellte sich schlafend. Da ging sie aus der Wohnung. Andreas wusste, sie ging den Vater suchen.
Andreas hatte Angst, er war allein, er konnte sich nicht mehr rühren. Die Kehle war wie zugeschnürt. Lange lag er ganz steif da. Er hörte das Ticken der Uhr, er hörte, wie sie elfmal schlug. Da hielt er es nicht länger aus. Er schlich im Nachthemd in den kalten Korridor hinter die Wohnungstür. Er drückte die Falle, die Tür war verschlossen. Andreas stand da und horchte ins Treppenhaus hinaus. Er hörte Schritte. Waren es die Eltern? Nein, die Schritte verhallten, eine Tür wurde geöffnet, Lachen drang aus der unteren Wohnung, dann war es wieder still. Andreas schlotterte, der Korridor war nicht geheizt. Jetzt schlug die Uhr zwölfmal. Eine lange Zeit verging, da vernahm er wieder Schritte, sie kamen höher und höher hinauf und … ja, es waren Vater und Mutter, er hörte ihre Stimmen, Gott sei Dank, Vaters Stimme klang nicht böse.
Da huschte Andreas schnell wieder in sein Bett, zog die Decke zu sich herauf, drehte sich zur Seite und schloss die Augen.
Die Wohnungstür wurde geöffnet. „Mach leise“, sagte die Mutter, „damit der Kleine nicht aufwacht.“ Sie kamen ins Kinderzimmer und sahen ihren schlafenden Jungen an. Lange sagten sie nichts. Da spürte Andreas plötzlich, wie der Vater ihm mit seiner harten Arbeiterhand über die Haare strich.
Als die Eltern gegangen waren, zog Andreas unter der Decke seine Knie ganz nahe zu sich heran und fing an zu schluchzen. Er schluchzte aus übergroßer Erleichterung, denn für diese Nacht war seine Welt wieder in Ordnung.
Onkel Giacomo
Es war im Jahre 1940 vor Ostern. Für die 7-jährige Marietta war Ostern das schönste Fest des Jahres. Da fuhren Vater Guiseppe, Mutter Erika, Marietta und ihr kleiner Bruder Carlo zur Nonna, der italienischen Großmutter, nach St. Gallen. Und man fuhr mit der Eisenbahn! Das kam nur einmal im Jahr vor, eben an Ostern.
Ostersonntag in der Früh stieg die Familie im Zürcher Hauptbahnhof in den Zug, in einen Wagen dritter Klasse. Die Bänke waren aus Holz, es roch nach abgestandenem Zigarettenrauch. Etliche Fahrgäste waren schon da. Ein Abteil mit 4 Plätzen war aber noch frei. Die Kinder stürzten zum Fenster, zogen es hinunter und streckten die Köpfe hinaus. „Lies mal, was auf diesem Email-Schild steht“, sagte der Vater zu Marietta.
„Nicht hinauslehnen“, buchstabierte sie. „Und da hat es noch eine Tafel, was steht da drauf?“, fragte Carlo.
„Nicht auf den Boden spucken“, las die Mutter vor. Da schaute sich Carlo um. Niemand sah zu ihm her. Schnell spuckte er verstohlen ein bisschen auf den Boden.
Der Zug fuhr an. War das aufregend! Ein wenig lehnte man schon zum Fenster hinaus und ließ sich den Wind durch die Haare wehen. An einigen Stationen hielt der Zug an. Nach etwa anderthalb Stunden war man am Ziel.
Die Nonna wohnte in der Altstadt. Als der Vater an der alten Wohnungstür läutete, öffnete die Großmutter. Sie war eben von der Ostermesse heimgekommen und trug noch ihr schwarzes Sonntags-Seidenkleid. Eine Goldkette mit einem Medaillon baumelte auf ihrer Brust, und in den Ohren trug sie goldene Ringe. Das noch fast schwarze Haar hatte sie kunstvoll aufgesteckt. „Meine lieben Schatzeli sind gekommen!“, rief sie und drückte Marietta und Carlo an ihr Herz. „Kommt herein.“ In der Stube saß am alten Klavier Onkel Giacomo, der schiefe Giacomo, wie ihn die Leute nannten. Er war Vaters jüngster Bruder und hatte ein Geburtsgebrechen. Seine linke Hüfte war verwachsen. Mit seinem schiefen Gang hinkte er der Familie entgegen. Er lächelte freundlich. „Tschau Bella“, sagte er zu Marietta. „Dürfen wir Klavier spielen, Onkel Giacomo?“, fragten die Kinder.
„Also, so kommt, ihr Rangen“, lachte er. Er zeigte ihnen geduldig die Tasten und lehrte Marietta „Alle meine Entlein“ spielen. Jetzt wollte es auch Carlo versuchen.
Da kam Cousine Ramona herbeigesprungen. Sie war die Tochter von Tante Norma, die bei der Nonna lebte. „Kommt, ich zeige euch mein Oster-Nestchen!“, rief sie. In ihrem Nestchen saß ein Osterhase aus rotem Zucker. So einen Hasen hatte Marietta noch nie gesehen. Die Osterhasen zu Hause waren immer aus Schokolade. Sofort wünschte sich Marietta sehnlichst einen solchen roten Hasen, wie Ramona ihn hatte. Da kam die Nonna herein und sagte zu Carlo und Marietta: „Suchen gehen, vielleicht hat es noch mehr Osternester.“ Und siehe da, sie fanden jedes ein Nestchen mit einem roten Zuckerhasen inmitten von kleinen Schoggieiern. Marietta war begeistert.
Da läutete es an der Wohnungstür, neuer Besuch kam. Laute Stimmen tönten durcheinander. Es waren Vaters Brüder Mario, Ettore und Bruno. Alle setzten sich an den runden Tisch. Die Nonna war glücklich. Ihre ganze Familie war da. Sie kam mit einer riesigen blechernen Kaffeekanne in die Stube. Der Kaffee war stark und bereits gesüßt. Tante Norma stellte geblümte Tassen auf den Tisch und brachte auf einer Platte einen großen Panettone. Die Kinder bekamen Sirup. Ein Korb mit gefärbten Ostereiern stand vor ihnen.
Nun begann zwischen Giuseppe, Ettore, Mario und Bruno ein Diskutieren und Gestikulieren, sie redeten laut, und zwar Italienisch. Besonders Ettore ereiferte sich zusehends, der elegante Bruno (er trug graue Wildledergamaschen über seinen modischen Schuhen) stichelte ihn immer mehr an. „Streiten sie?“, fragte Carlo die Nonna.
„Nein, nein, politisieren, immer nur politisieren, und das an Ostern“, schimpfte sie. Onkel Bruno lachte. „Mamma mia!“, rief er und legte seinen Arm zärtlich um die Nonna. „Geh du zur Madonna in die Kirche und zünde für uns Sünder eine Kerze an.“
Onkel Giacomo aber saß an einem kleinen Nebentisch, er hatte einen großen Zeichenblock vor sich. Außer Klavierspielen hatte er noch mehr Talente. Er konnte wunderbar zeichnen. Durch seinen schwarzen Stift entstanden Karikaturen von allen Anwesenden.
Die Kinder machten „Eiertütschis“, dazwischen liefen sie zu Giacomo und jubelten, wenn sie wieder ein Familienmitglied erkannten. Zuletzt hinkte der Onkel an den großen Tisch und legte jedem sein Konterfei hin. Da gab es verblüffte Gesichter. Es ist ja nicht immer so angenehm, sich als Karikatur zu sehen. Zuletzt aber siegte der Humor, und alle lachten.
„Onkel Giacomo, zauberst du noch ein wenig?“, fragte Carlo.
„Ach, zaubern, schaut lieber mal zu euren Osternestern“, meinte er. Ja, was sahen da die Kinder? Nur noch ein paar Schoggi-Eilein lagen darin, die roten Zuckerhasen waren verschwunden.
Jetzt begann ein Suchen. Die Nonna kam mit einer neuen Kanne Kaffee herein, und was guckte da aus der Tasche ihrer Küchenschürze? Etwas Rotes. „Das ist mein Hase!“, rief Ramona und ergriff ihn schnell. Marietta musterte den grau-schwarz gestreiften Blazer von Onkel Bruno und sah plötzlich zwei rote Ohren aus seiner Tasche gucken. „Mein Hase!“, rief sie und packte ihn. Fast gleichzeitig entdeckte auch Carlo seinen Osterhasen, er saß auf Vaters Schoß.
Nun kehrten die Kinder zu ihrem Korb mit den bunten Eiern zurück. Aber da waren keine Eier mehr! Onkel Giacomo humpelte herum. Er zog ein rotes Ei aus Onkel Ettores Jackenärmel, ein blaues aus dem Hosenbein von Onkel Mario, ein grünes sogar aus dem runden Ausschnitt von Tante Norma. Die Erwachsenen lachten, die Kinder staunten.
Plötzlich aber war Onkel Giacomo müde. Er kehrte still an seinen Platz zurück. Die Kinder wussten: Jetzt musste man ihn in Ruhe lassen.
Als es Abend wurde, stellte Tante Norma vor jeden Platz einen Suppenteller mit Löffel, dann kam sie mit einer großen Schüssel Minestrone, nach Nonnas Geheimrezept zubereitet, herein. Dazu gab es Weißbrot, Salami und Coppa. Zwei große Korbflaschen Chianti standen da, das Fest konnte weitergehen.
Dann war es Zeit zum Aufbrechen. Marietta lief noch schnell zu Onkel Giacomo. Er saß still auf seinem Stuhl mit einem Kissen im Rücken und hatte die Augen geschlossen. „Danke, Onkel Giacomo“, sagte Marietta.
Er öffnete die Augen. Ein müdes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. „Hat es euch Spaß gemacht?“, fragte er. Er drückte Mariettas Hand. „Tschau Bella“, sagte er noch und schloss wieder die Augen.
„Sepp“, sagte auf der Heimfahrt die Mutter zu ihrem Mann: „Du hast eine herrliche Familie. Bin ich froh, einen Italiener geheiratet zu haben.“ Und sie gab ihm einen Kuss.
„Am liebsten von allen habe ich Onkel Giacomo“, sagte Carlo. „Er kann so viele tolle Sachen.“
Wie hat er nur meinen roten Zucker-Osterhasen in Onkel Brunos Jackentasche gezaubert?, dachte Marietta.